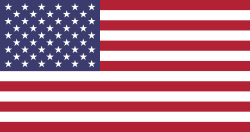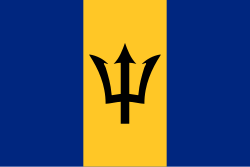Squash bei den Panamerikanischen Spielen
Squash ist seit 1995 Bestandteil der Panamerikanischen Spiele. In zunächst vier Wettbewerben erfolgte eine Medaillenvergabe: Bei den Damen und Herren, jeweils im Einzel- als auch im Mannschaftswettbewerb. Seit 2011 gibt es auch einen Doppelwettbewerb für beide Geschlechter, sodass insgesamt sechs Medaillen im Squash vergeben werden.[1]
Bilanz
Mit insgesamt 13 von 35 möglichen Goldmedaillen ist Kanada die erfolgreichste Nation. Zudem gelang es Kanada bei den Spielen im heimischen Winnipeg 1999 sämtliche Wettbewerbe zu gewinnen. Die Vereinigten Staaten gewannen bislang elfmal Gold, Kolumbien und Mexiko jeweils fünfmal. Während bei den Kanadiern beide Geschlechter gleichermaßen erfolgreich waren, fällt bei den Vereinigten Staaten die weibliche Dominanz auf: Von 30 Medaillen wurden nur acht im Herrenbereich gewonnen.
In den Einzelwettbewerben findet kein Spiel um die Bronzemedaille statt. Die Verlierer der Halbfinals erhalten beide Bronze. In den Teamwettbewerben konnte der Veranstalter eigenständig entscheiden. So kam es 1995 zu einem Spiel um Bronze, seitdem entfiel das Duell.
Herren
Bis 2007 gelang es niemandem die kanadische Dominanz zu brechen. Erst in Rio de Janeiro gewann mit dem Mexikaner Eric Gálvez erstmals ein Squashspieler Gold, der nicht aus Kanada stammte. Im Mannschaftswettbewerb musste sich Kanada ebenfalls beugen, man unterlag im Finale gegen die kolumbianische Auswahl. Überraschenderweise konnte sich Jonathon Power, ehemals Weltmeister und Weltranglistenerster, nie in die Liste der Goldgewinner eintragen. Lediglich eine Silbermedaille bei den Spielen 1995 in Mar del Plata steht für ihn zu Buche. Damit bleibt der Sieg im Einzel bei den Panamerikanischen Spielen einer der ganz wenigen Titel, die Power nie gewinnen konnte.
Einzel
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| 2019 | ||||
| 2015 | ||||
| 2011 | ||||
| 2007 | ||||
| 2003 | ||||
| 1999 | ||||
| 1995 |
Doppel
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| 2019 | ||||
| 2015 | ||||
| 2011 |
Mannschaft
Damen
Die Finals der Damenwettbewerbe waren mit Ausnahme der Austragung 2011 stets eine rein kanadisch-US-amerikanische Angelegenheit. Die Kanadierinnen konnten dabei fünf der acht Endspiele gewinnen. Erst 2011 gelang es der Mexikanerin Samantha Terán, das Finale zu erreichen.
Einzel
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| 2019 | ||||
| 2015 | ||||
| 2011 | ||||
| 2007 | ||||
| 2003 | ||||
| 1999 | ||||
| 1995 |
Doppel
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| 2019 | ||||
| 2015 | ||||
| 2011 |
Mannschaft
Mixed
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| 2019 |
Medaillenspiegel Gesamt
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 11 | 36 | |
| 2 | 13 | 16 | 17 | 46 | |
| 3 | 8 | 5 | 10 | 23 | |
| 4 | 5 | 4 | 19 | 28 | |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | — | 3 | 6 | 9 | |
| 7 | — | 2 | 7 | 9 | |
| 8 | — | — | 2 | 2 | |
| — | — | 2 | 2 | ||
| — | — | 2 | 2 | ||
| 11 | — | — | 1 | 1 | |
| — | — | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 42 | 42 | 82 | 166 | |
Einzelnachweise
- ↑ Alle Ergebnisse der Vergangenheit, worldsquash.org, abgerufen am 1. August 2019.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Die Flagge der Dominikanischen Republik hat ein zentriertes weißes Kreuz, das bis zu den Rändern reicht. Dieses Emblem ähnelt dem Flaggendesign und zeigt eine Bibel, ein Kreuz aus Gold und sechs dominikanische Flaggen. Um den Schild herum sind Oliven- und Palmzweige und oben am Band steht das Motto "Dios, Patria, Libertad" ("Gott, Land, Freiheit") und zur liebenswürdigen Freiheit. Das Blau soll für Freiheit stehen, Rot für das Feuer und Blut des Unabhängigkeitskampfes und das weiße Kreuz symbolisierte, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. "Dominikanische Republik". Die dominikanische Flagge wurde von Juan Pablo Duarte, dem Vater der nationalen Unabhängigkeit der Dominikanischen Republik, entworfen. Die erste dominikanische Flagge wurde von einer jungen Dame namens Concepción Bona genäht, die in der Nacht des 27. Februar 1844 gegenüber der Straße von El Baluarte, dem Denkmal, an dem sich die Patrioten versammelten, um für die Unabhängigkeit zu kämpfen, wohnte. Concepción Bona wurde von ihrer Cousine ersten Grades unterstützt Maria de Jesús Pina.