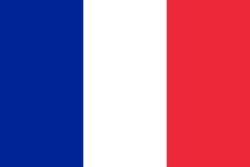Olympische Sommerspiele 1968/Leichtathletik – Stabhochsprung (Männer)
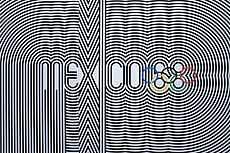 | |||||||||
| Sportart | Leichtathletik | ||||||||
| Disziplin | Stabhochsprung | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 23 Athleten aus 15 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Estadio Olímpico Universitario | ||||||||
| Wettkampfphase | 14. Oktober 1968 (Qualifikation) 16. Oktober 1968 (Finale) | ||||||||
| |||||||||

Der Stabhochsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt wurde am 14. und 16. Oktober 1968 im Estadio Olímpico Universitario ausgetragen. 23 Athleten nahmen teil.
Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Bob Seagren. Silber gewann Claus Schiprowski aus der Bundesrepublik Deutschland, Bronze ging an Wolfgang Nordwig aus der DDR.
Für die Bundesrepublik Deutschland – offiziell Deutschland – starteten neben Silbermedaillengewinner Schiprowski Heinfried Engel und Klaus Lehnertz. Während Lehnertz an der Qualifikationshöhe scheiterte, qualifizierte sich Engel für das Finale, in dem er Achter wurde.
Die DDR – offiziell Ostdeutschland – wurde durch Bronzemedaillengewinner Nordwig vertreten.
Für die Schweiz startete Heinz Wyss, der in der Qualifikation scheiterte.
Der Österreicher Ingo Peyker schaffte in der Qualifikation keine gültige Höhe.
Springer aus Liechtenstein nahmen nicht teil.
Rekorde
Bestehende Rekorde
| Weltrekord | 5,41 m | Bob Seagren ( | Echo Summit, USA | 12. September 1968[1] |
| Olympischer Rekord | 5,10 m | Fred Hansen ( | Finale OS Tokio, Japan | 17. Oktober 1964 |
Rekordegalisierungen / -verbesserungen
Der bestehende olympische Rekord wurde im Finale am 16. Oktober zunächst fünfmal egalisiert und anschließend 28 Mal verbessert:
| 5,10 m (egalisiert) | ||
| Claus Schiprowski (BR Deutschland), erster Versuch | Heinfried Engel (BR Deutschland), zweiter Versuch | |
| Hennadij Blesnizow (Sowjetunion), erster Versuch | Ignacio Sola (Spanien), zweiter Versuch | |
| Kiyoshi Niwa (Japan), erster Versuch | ||
| 5,15 m | ||
| Christos Papanikolaou (Griechenland), erster Versuch | Hervé d’Encausse (Frankreich), zweiter Versuch | |
| Ignacio Sola (Spanien), erster Versuch | Kiyoshi Niwa (Japan), zweiter Versuch | |
| Kjell Isaksson (Schweden), erster Versuch | ||
| 5,20 m | ||
| Claus Schiprowski (BR Deutschland), erster Versuch | Bob Seagren (USA), zweiter Versuch | |
| Wolfgang Nordwig (DDR), erster Versuch | John Pennel (USA), zweiter Versuch | |
| Hennadij Blesnizow (Sowjetunion), erster Versuch | Ignacio Sola (Spanien), dritter Versuch | |
| Heinfried Engel (BR Deutschland), erster Versuch | ||
| 5,25 m | ||
| Hervé d’Encausse (Frankreich), erster Versuch | Claus Schiprowski (BR Deutschland), zweiter Versuch | |
| Christos Papanikolaou (Griechenland), zweiter Versuch | ||
| 5,30 m | ||
| Hennadij Blesnizow (Sowjetunion), erster Versuch | Christos Papanikolaou (Griechenland), zweiter Versuch | |
| Claus Schiprowski (BR Deutschland), erster Versuch | John Pennel (USA), zweiter Versuch | |
| Wolfgang Nordwig (DDR), erster Versuch | Hennadij Blesnizow (Sowjetunion), zweiter Versuch | |
| 5,35 m | ||
| Wolfgang Nordwig (DDR), erster Versuch | Claus Schiprowski (BR Deutschland), zweiter Versuch | |
| Christos Papanikolaou (Griechenland), erster Versuch | John Pennel (USA), dritter Versuch | |
| 5,40 m | ||
| Bob Seagren (USA), zweiter Versuch | Wolfgang Nordwig (DDR), dritter Versuch | |
| Claus Schiprowski (BR Deutschland), zweiter Versuch | ||
Durchführung des Wettbewerbs
23 Springer traten am 14. Oktober in zwei Gruppen zu einer Qualifikationsrunde an. Fünfzehn von ihnen – hellblau unterlegt – übersprangen mit 4,90 m die Höhe für die direkte Finalqualifikation. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmern übertroffen und diese fünfzehn Wettbewerber bestritten am 16. Oktober das Finale.
Zeitplan
14. Oktober, 10:00 Uhr: Qualifikation
16. Oktober, 12:30 Uhr: Finale[2]
Anmerkung: Alle Zeiten sind in Ortszeit Mexiko-Stadt (UTC −6) angegeben.
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
| – | verzichtet |
| o | übersprungen |
| x | ungültig |
Qualifikation
Datum: 14. Oktober 1968, ab 10:00 Uhr[3]
Gruppe A
| Platz | Name | Nation | 4,20 m | 4,30 m | 4,40 m | 4,50 m | 4,60 m | 4,70 m | 4,75 m | 4,80 m | 4,85 m | 4,90 m | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Nordwig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | 4,90 m | |
| John Pennel | |||||||||||||
| 3 | Hervé d’Encausse | – | – | – | – | – | – | – | o | – | o | 4,90 m | |
| Christos Papanikolaou | |||||||||||||
| Claus Schiprowski | |||||||||||||
| Altti Alarotu | – | – | – | – | – | o | – | – | – | o | 4,90 m | ||
| Hennadij Blesnizow | – | – | – | – | o | – | – | – | – | o | 4,90 m | ||
| Erkki Mustakari | |||||||||||||
| 9 | Bob Seagren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | xo | 4,90 m | |
| 10 | Kjell Isaksson | – | – | – | – | – | o | – | – | – | xo | 4,90 m | |
| 11 | Heinfried Engel | – | – | – | – | o | – | – | o | – | xxo | 4,90 m | |
| 12 | Casey Carrigan | – | – | – | – | o | – | – | – | – | xxx | 4,60 m |
Gruppe B
| Platz | Name | Nation | 4,20 m | 4,30 m | 4,40 m | 4,50 m | 4,60 m | 4,70 m | 4,75 m | 4,80 m | 4,85 m | 4,90 m | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Bull | – | – | – | – | o | – | – | o | – | o | 4,90 m | |
| Kiyoshi Niwa | |||||||||||||
| Ignacio Sola | |||||||||||||
| 4 | Alexander Maljutin | – | – | xxo | o | – | o | – | xxo | – | o | 4,90 m | |
| 5 | Pantelis Nikolaidis | – | – | o | – | o | – | – | o | – | xxx | 4,80 m | |
| 6 | Enrico Barney | o | o | – | xo | o | xxo | – | o | – | xxx | 4,80 m | |
| 7 | Klaus Lehnertz | – | – | o | – | o | – | o | – | xxx | 4,75 m | ||
| 8 | John-Erik Blomqvist | – | – | – | – | o | – | xxo | – | – | xxx | 4,75 m | |
| 9 | Wu Ah-min | o | o | – | o | xxx | 4,50 m | ||||||
| 10 | Heinz Wyss | – | xo | – | o | – | xxx | 4,50 m | |||||
| NM | Ingo Peyker | – | – | – | – | xxx | ogV |
Finale
Datum: 14. Oktober 1968, 12:30 Uhr[3]
| Platz | Name | Nation | Sprunghöhen (m) | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,05 | 5,10 | 5,15 | 5,20 | 5,25 | 5,30 | 5,35 | 5,40 | 5,45 | ||||
| 1 | Bob Seagren | – | – | – | – | – | o | – | – | xo OR | – | o OR | – | xo OR | xxx | 5,40 m OR | |
| 2 | Claus Schiprowski | – | – | – | o | o | – | o ORe | – | o OR | xo OR | o OR | xo OR | xo OR | xxx | 5,40 m OR | |
| 3 | Wolfgang Nordwig | – | – | – | – | xo | – | – | – | o OR | – | o OR | o OR | xxo OR | xxx | 5,40 m OR | |
| 4 | Christos Papanikolaou | – | – | o | – | o | – | – | o OR | – | xo OR | xo OR | o OR | xxx | 5,35 m | ||
| 5 | John Pennel | – | – | – | – | – | o | – | – | xo OR | – | xo OR | xxo OR | xxx | 5,35 m | ||
| 6 | Hennadij Blesnizow | – | o | – | o | – | – | o ORe | – | o OR | – | xo OR | xxx | 5,30 m | |||
| 7 | Hervé d’Encausse | – | – | – | – | o | – | – | xo OR | – | o OR | – | xxx | 5,25 m | |||
| 8 | Heinfried Engel | – | – | o | – | xxo | – | xo ORe | – | o OR | xxx | 5,20 m | |||||
| 9 | Ignacio Sola | – | – | xo | – | o | – | xo ORe | o OR | xxo OR | xxx | 5,20 m | |||||
| 10 | Kjell Isaksson | – | – | – | o | – | xo | – | o OR | xxx | 5,15 m | ||||||
| 11 | Kiyoshi Niwa | – | – | o | o | o | – | o ORe | xo OR | xxx | 5,15 m | ||||||
| 12 | Alexander Maljutin | – | o | – | o | o | – | xxx | 5,00 m | ||||||||
| 13 | Mike Bull | – | – | xo | o | xo | – | xxx | 5,00 m | ||||||||
| 14 | Altti Alarotu | – | – | – | – | xxo | – | – | 5,00 m | ||||||||
| NM | Erkki Mustakari | – | – | xxx | ogV | ||||||||||||
Die Entwicklung im Stabhochsprung war seit den letzten Spielen mit Riesenschritten weitergegangen. 5,10 m waren vor vier Jahren in Tokio für Fred Hansen notwendig gewesen, um Olympiasieger zu werden. Inzwischen hatte der US-Springer Bob Seagren den Weltrekord auf 5,41 m hochgeschraubt und es gab weitere Athleten, die mit Bestleistungen im Bereich zwischen 5,30 m und 5,40 m aufwarten konnten. Das Favoritenfeld war also ziemlich groß. Neben Seagren gehörten u. a. auch dessen Landsmann John Pennel, der Ostdeutsche Wolfgang Nordwig, der Grieche Christos Papanikolaou und der Franzose Hervé d’Encausse dazu.[4]
Das siebenstündige Finale blieb lange offen, das Niveau war noch höher als erwartet und es kam zu enormen persönlichen Verbesserungen einiger Springer. Nach 5,30 m waren noch sieben Athleten im Rennen. Zwei von ihnen, der Franzose d’Encausse und Hennadij Blesnizow aus der UdSSR, scheiterten an 5,35 m. Als 5,40 m aufgelegt wurden, waren somit immer noch fünf Springer dabei, die sich um die Medaillen stritten. Pennel und Papanikolaou scheiterten hier dreimal. Pennels zweiter Sprung wäre heute allerdings gültig gewesen. Nach damaliger Regelung war der Versuch nur deshalb ungültig, weil der Stab unter der Latte hindurch gefallen war – ein Relikt aus der Zeit, als die Stäbe noch länger waren als die zu überspringenden Höhen. Seagren und der Deutsche Claus Schiprowski, der mit einer Bestleistung von 5,18 m angereist war, übersprangen die Höhe jeweils im zweiten Versuch, Nordwig bewältigte sie im dritten.
An der neuen Weltrekordhöhe von 5,45 m scheiterten alle drei verbliebenen Springer. Aufgrund der Fehlversuchsregel wurde Bob Seagren – zwei Fehlversuche – Olympiasieger. Claus Schiprowski, der drei Fehlsprünge im Laufe des Wettkampfes hatte, gewann die Silbermedaille, Wolfgang Nordwig wurde Dritter.
Auch im sechzehnten olympischen Finale gab es einen US-Sieg. Es war die siebzehnte Goldmedaille für die USA in dieser Disziplin – 1908 hatte es zwei Goldmedaillen gegeben.
Weltrekordinhaber Bob Seagren (Foto: 2012) gewann Gold in einem äußerst hochklassigen Wettbewerb
Kjell Isaksson (hier bei den
Europameisterschaften 1974) belegte Rang zehn
Literatur
- Ekkehard zur Megede, Die Geschichte der olympischen Leichtathletik, Band 2: 1948–1968, Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 1. Auflage 1969, S. 358 bis 360
Videolinks
- Bob Seagren Wins High Jump Gold - Classic Moments - Mexico City 1968 Olympic Film, Bereiche 6:05 min bis 7:02 min / 7:34 min bis 8:38 min / 10:19 min bis 49 min, youtube.com, abgerufen am 8. November 2017
- Olympics (1968), Bereich: 0:00 min bis 0:28 min, youtube.com, abgerufen am 19. September 2021
Weblinks
- Seite des IOC: Mexico City 1968, Athletics pole vault men Results, olympics.com (englisch), abgerufen am 19. September 2021
- The Games, Produced by the Organizing Committee of the Games Mexico 68, Vol. 3, pole vault, komplette Resultate digital.la84.org, engl./französ. (PDF; 36.300 KB), S. 527, digital.la84.org, abgerufen am 19. September 2021
- Athletics at the 1968 Ciudad de Mexico Summer: Men's pole vault, web.archive.org, sports-reference.com, abgerufen am 19. September 2021
- Olympedia, Athletics at the 1968 Summer Olympics, Pole Vault, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 19. September 2021
- The Games, Produced by the Organizing Committee of the Games Mexico 68, Vol. 3, Überblick mit Fotos digital.la84.org, engl./französ. (PDF; 36.300 KB), S. 90 bis 93, digital.la84.org, abgerufen am 19. September 2021
Einzelnachweise
- ↑ Athletics - Progression of outdoor world records, Pole vault – Men, sport-record.de, abgerufen am 19. September 2021
- ↑ The Games, Produced by the Organizing Committee of the Games Mexico 68, Vol. 3 digital.la84.org, engl./französ. (PDF; 36.300 KB), S. 10, digital.la84.org, abgerufen am 19. September 2021
- ↑ a b The Games, Produced by the Organizing Committee of the Games Mexico 68, Vol. 3 digital.la84.org, engl./französ. (PDF; 36.300 KB), S. 527, digital.la84.org, abgerufen am 19. September 2021
- ↑ Athletics at the 1968 Ciudad de Mexico Summer: Men's pole vault, web.archive.org, sports-reference.com, abgerufen am 19. September 2021
Auf dieser Seite verwendete Medien
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Autor/Urheber: Agência Brasil Fotografias, Lizenz: CC BY 2.0
Rio de Janeiro - Exposição Design & Utopia dos Jogos, no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, apresenta peças de comunicação dos Jogos Olímpicos de Tókio, México, Munique, Los Angeles e Barcelona (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Die Olympiaflagge der gesamtdeutschen Mannschaft von 1960 und 1964, sowie beider deutschen Mannschaften 1968.
Die Olympiaflagge der gesamtdeutschen Mannschaft von 1960 und 1964, sowie beider deutschen Mannschaften 1968.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: Sergio V. Rodriguez, Lizenz: CC BY-SA 4.0
University Stadium, Mexico City, MEX 1968
Flagge von Königreich Griechenland (1863-1924; 1935-1973).
Flagge von Königreich Griechenland (1863-1924; 1935-1973).
Flagge Finnlands
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Autor/Urheber: SanchoPanzaXXI, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Autor/Urheber: SanchoPanzaXXI, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
(c) ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Sonderegger, Christof / Com_L23-0644-0002-0015 / CC BY-SA 4.0
Leichtathletik-Europameisterschaften 1974 in Rom
(c) Bundesarchiv, Bild 183-C0216-0010-004 / CC-BY-SA 3.0
Autor/Urheber: Trackinfo, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Bob Seagren at the 2012 CCCAA State Championships