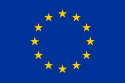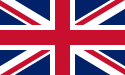Kapitalverkehrsteuer
Kapitalverkehrsteuern sind in der Finanzwissenschaft und Steuerlehre eine Steuergruppe, die als Steuerobjekte Transaktionen des Kapitalverkehrs besteuert.
Allgemeines
In Deutschland wird im Steuerrecht, vor allem in der Amtssprache und in der Finanzwissenschaft, traditionell das Fugen-s weggelassen (Körperschaftsteuer, Verbrauchsteuer, Aufwandsteuer);[1] in Österreich und der Schweiz dagegen meist verwendet.
Kapitalverkehrsteuern gehören zu den Verkehrsteuern. Durch Verkehrsteuern wird die Einkommensverwendung in vielfältiger Weise besteuert, wobei jedoch die persönliche Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners nicht berücksichtigt wird.[2]
Steuerarten
Es gibt oder gab folgende Steuerarten:[3]
| Steuergruppe | Steuerart | Steuerobjekt |
|---|---|---|
| Kapitalverkehrsteuern | Börsenumsatzsteuer Finanztransaktionssteuer Gesellschaftsteuer Wertpapiersteuer | Umsatz an Effekten Besteuerung von börslichen und außerbörslichen Finanztransaktionen Besteuerung des Ersterwerbs von Anteilen an Kapitalgesellschaften Besteuerung der Anschaffung von Schuldverschreibungen |
| Rechtsverkehrsteuern | Feuerschutzsteuer Grunderwerbsteuer Rennwett- und Lotteriesteuer Schankerlaubnissteuer Spielbankabgabe Versicherungsteuer | Besteuerung von Versicherungsprämien für Feuerversicherungen Besteuerung vom Grundstückserwerb Besteuerung von Rennwetten und Lotterien Besteuerung der Schankerlaubnis Besteuerung der Betreiber öffentlicher Spielbanken Besteuerung des Abschlusses von Versicherungsverträgen |
| Realverkehrsteuern | Kraftfahrzeugsteuer | Besteuerung des Kraftfahrzeughaltens |
Die Wertpapiersteuer wurde im Dezember 1964 abgeschafft, die Börsenumsatzsteuer und Gesellschaftsteuer folgten im Dezember 1991. Derzeit gibt es in Deutschland keine Kapitalverkehrsteuer.
International
 Europäische Union
Europäische Union
Eine Finanztransaktionssteuer in allen EU-Mitgliedstaaten wird seit 2011 intensiv diskutiert, aber konnte bisher nicht erreicht werden. Lediglich einzelne Staaten wie Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Spanien oder Zypern führten eine Art Börsenumsatzsteuer ein.[4]
Im Frühjahr 2012 starteten neun EU-Länder einen neuen Vorstoß, eine Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene einzuführen, scheiterten aber vor allem am Widerstand der beiden Nicht-Euro-Länder Großbritannien und Schweden. Die Alternative, die Steuer nur in der Eurozone einzuführen, scheiterte wiederum am Widerstand von Luxemburg und den Niederlanden.[5] Im Juni 2012 wurde die Zielsetzung einer Einführung in der gesamten Eurozone aufgegeben. Die verbleibenden EU-Länder einigten sich darauf, die Finanztransaktionssteuer nunmehr nur in den befürwortenden Ländern einzuführen.[6]
 Schweiz
Schweiz
In der Schweiz wird eine Umsatzabgabe von 1,5 ‰ für inländische Wertpapiere und 3,0 ‰ für ausländische Wertpapiere erhoben, wobei zahlreiche Ausnahmen und Befreiungen für institutionelle Anleger, Wertpapierfonds und Versicherungsunternehmen eine umfassende Besteuerung ausschließen.
 Österreich
Österreich
In Österreich werden die Wertpapiersteuer (seit Jänner 1995), die Börsenumsatzsteuer (seit Oktober 2000) und die Gesellschaftsteuer (seit Jänner 2016) nicht mehr erhoben.[7]
 Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich
In Großbritannien gibt es eine seit 1986 existierende Stempelsteuer (englisch Stamp duty reserve tax (SDRT)) für den Handel mit Aktien inländischer Aktiengesellschaften an der Börse.
Wirtschaftliche Aspekte
Eine der ersten Überlegungen zu einer Besteuerung des Aktienmarkts geht auf John Maynard Keynes nach der Great Depression aus dem Jahre 1936 zurück.[8] Keynes war der Auffassung, dass eine solche Steuer die Spekulation begrenzen könne.[9] Dabei übersah er nicht, dass eine Besteuerung durchaus neue Investitionen behindern könnte.[10] Seither werden in den Wirtschaftswissenschaften Kapitalverkehrsteuern oft kritisch bewertet, weil diese als Transaktionskosten die Effizienz der Wertpapiermärkte senkten. So stellten Karl Friedrich Habermeier und Andrei Pawlowitsch Kirilenko in einer Studie des IWF fest, dass Transaktionssteuern negative Effekte auf Volatilität und Marktliquidität von Märkten haben und zu einer geringeren Informationseffizienz führen.[11] In einer Studie über Änderungen in der finnischen und schwedischen Börsenumsatzsteuer haben Peter Swan und Joakim Westerholm festgestellt, dass eine Verringerung von Transaktionskosten zu deutlich niedrigerer Volatilität führt.[12] Transaktionskosten können die Umschlagshäufigkeit auf Finanzmärkten verringern, weil Marktteilnehmer sie bei ihren Transaktionen im Hinblick auf Gewinne oder Renditen zu berücksichtigen haben. Überall dort, wo sie erhoben werden oder wurden, waren sie lediglich Bagatellsteuern mit relativ geringem Steueraufkommen.
Mit einer Kapitalverkehrsteuer werden zunächst die Finanzintermediäre belastet, die diese Steuern in der Bankkalkulation der Finanzprodukte oder Finanzinstrumente den nachfragenden Kunden als indirekte Steuern weiterbelasten (lediglich beim Eigenhandel sind die Finanzintermediäre selbst direkt belastet). Hierdurch kommt es zur Steuerüberwälzung, so dass die Steuern im Endeffekt (durch höhere Provisionen oder Zinssätze) ganz oder teilweise durch die Anleger als Steuerträger getragen werden. Eine Steuerüberwälzung gelingt vollständig, wenn auf einem Finanzmarkt eine vollkommen unelastische Nachfrageelastizität (die Nachfrage ist vom Marktpreis unabhängig) vorhanden ist.[13]
Sollen Kapitalverkehrsteuern ihre Funktion als Lenkungssteuern ausüben, müssen sämtliche Transaktionen auf den Finanzmärkten besteuert werden. Tatsächlich aber werden lediglich Teilbereiche mit einzelnen Steuerarten belastet.
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Jürgen Dittmann, Richtiges Deutsch leicht gemacht, 2009, S. 351
- ↑ Christoph Sprengel, Verkehrsteuern, in: Wolfgang Lück (Hrsg.), Lexikon der Rechnungslegung und Abschlussprüfung, 1998, S. 847
- ↑ Franz Dötsch, Verkehrsteuern, in: Wolfgang Lück (Hrsg.), Lexikon der Betriebswirtschaft, 2004, S. 705
- ↑ Die Welt vom 2. August 2012, Frankreich wagt den Alleingang abgerufen am 2. August 2012.
- ↑ Cerstin Gammelin: Finanzmarktsteuer in der EU gescheitert – vorerst. Sueddeutsche, 13. März 2012, abgerufen am 13. März 2012.
- ↑ focus.de., Merkel will Finanztransaktionssteuer vorantreiben.
- ↑ WKO.at, Stichwort: Kapitalverkehrsteuern, abgefragt 11. Dezember 2022.
- ↑ John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, S. 105
- ↑ John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, S. 143
- ↑ John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, S. 144
- ↑ Karl Friedrich Habermeier/Andrei Kirilenko, Securities Transaction Taxes and Financial Markets, IMF Working Paper 01/51 (engl.)
- ↑ Peter Swan/Joakim Westerholm, The Impact Of Transaction Costs On Turnover And Asset Prices; The Cases Of Sweden's And Finland's Security Transaction Tax Reductions, CEIS Working Paper 144, Archivlink (Memento vom 11. Oktober 2008 im Internet Archive) (engl.)
- ↑ Alfred Kyrer/Walter Penker, Volkswirtschaftslehre: Grundzüge der Wirtschaftstheorie und -politik, 2000, S. 71
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die Europaflagge besteht aus einem Kranz aus zwölf goldenen, fünfzackigen, sich nicht berührenden Sternen auf azurblauem Hintergrund.
Sie wurde 1955 vom Europarat als dessen Flagge eingeführt und erst 1986 von der Europäischen Gemeinschaft übernommen.
Die Zahl der Sterne, zwölf, ist traditionell das Symbol der Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit. Nur rein zufällig stimmte sie zwischen der Adoption der Flagge durch die EG 1986 bis zur Erweiterung 1995 mit der Zahl der Mitgliedstaaten der EG überein und blieb daher auch danach unverändert.Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.