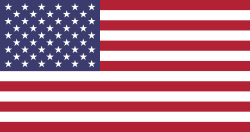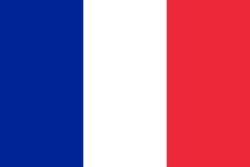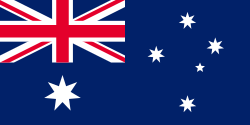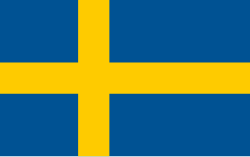Juden
Als Juden und Jüdinnen (hebräisch יְהוּדִיםjehudim, יְהוּדִיּוֹתjehudi'ot) bezeichnet man Menschen, die zum Judentum gehören. Das Wort „Jude“ ist vom hebräischen Personennamen Jehuda, den Gebietsnamen Jehud und Judäa abgeleitet und bezeichnet die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk, das sich meist als Abstammungs- und Glaubensgemeinschaft versteht. Dieses geht historisch auf die Israeliten zurück, deren Glaubenstraditionen im Tanach, der hebräischen Bibel, bewahrt sind. Religiöse wie nichtreligiöse Juden verstehen sich im Anschluss an die Bibel als Teil dieses Volkes, einer durch Abstammung und Geschichte verbundenen Schicksalsgemeinschaft.
Die Halacha (das jüdische Recht aus Mischna und Talmud) definiert von einer jüdischen Mutter geborene oder zum Judentum übergetretene Menschen als Juden. Teile des Judentums betrachten zudem Kinder eines jüdischen Vaters und einer nichtjüdischen Mutter als Juden und erleichtern ihnen den Übertritt.
Bezeichnungen
„Israel“
Die später als Juden bezeichnete ethnisch-religiöse Gruppe erscheint historisch unter dem Namen „Israel“ (hebräisch יִשְׂרָאֵלJisra'el), zuerst belegt auf der ägyptischen Merenptah-Stele (1208 v. Chr.). In der Bibel verleiht der Gott JHWH diesen Namen dem Stammvater Jakob (Gen 32,29 ), der ihn an die von ihm abstammenden Zwölf Stämme Israels vererbt. Ab Ex 1,9 heißen alle ihre beim Auszug aus Ägypten befreiten Nachkommen „das Volk der Kinder Israels“ oder „das Volk der Israeliten“.[1]
„Israel“ hieß dieses Volk und sein Gebiet biblisch auch als Königreich unter Saul, David und Salomo. Nach der biblisch überlieferten Teilung dieses Reichs behielt das größere Nordreich Israel den Namen, außerbiblisch belegt unter anderem auf der Mescha-Stele. Nach dessen Untergang (722/720 v. Chr.) bezeichnete vor allem die biblische Prophetie das verbliebene Südreich Juda und dessen ins Babylonische Exil (587–539 v. Chr.) deportierte Bewohner als „Israel“ (Jer 17,13 ). Auch die Gemeinschaft der Exilheimkehrer und der Staat der Hasmonäer behielten diesen Namen,[1] ebenso die seit etwa 300 v. Chr. entstandene Gruppe der Samaritaner. Sie nannten sich selbst auch in der Diaspora „Israeliten“.[2]
Im 1. Jahrhundert nannten sich die unterdrückten Bewohner der römischen Provinz Judäa und Samaria weiterhin „Volk Israel“ (Am Jisra'el), um an ihre biblische Frühgeschichte zu erinnern und ihre Identität als Nachkommen der Israeliten zu bewahren.[3] Auch das Urchristentum und sein Neues Testament (NT) nannten dieses Volk im Raum Palästina selbstverständlich „Israel“ und seine Angehörigen „Israelit(en)“, etwa in Joh 1,47 , 2 Kor 11,22 , Röm 9,4 und 11,1 sowie in Apg 2,22 , 3,12 , 5,35 , 13,16 und 21,28 .[4]
Das nachbiblische rabbinische Judentum blieb sich seiner Identität mit „Israel“ auch nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 voll bewusst. Der Name bezeichnet also das biblische erwählte Gottesvolk, dessen (geografisch und politisch verschieden bestimmtes) Land und die Abstammungsgemeinschaft aller seiner Nachkommen. Darum verwendeten viele Juden und Nichtjuden die Bezeichnungen „Israel“ und „Judentum“ schon lange vor der Gründung des modernen Staates Israel 1948 synonym.[1]
Jehudi
Das deutsche Wort „Juden“ geht wie das englische Jews, das französische Juifs und die Äquivalente weiterer Sprachen auf das hebräische Wort יְהוּדִיJehudi zurück. Es ist vom Vornamen Jehuda abgeleitet, der in der griechischen Bibelübersetzung Septuaginta zu Juda gräzisiert wurde. Dessen Wurzel j–h–d enthält eine Kurzform des Gottesnamens JHWH und bedeutet „Gott preisen, danken“. So nannte Jakobs Frau Lea laut Gen 29,35 ihren vierten Sohn, der zum Stammvater des größten israelitischen Stammes wurde.[5]
„Juda“ bezeichnet im Tanach daher zunächst diesen Stamm und sein Siedlungsgebiet. König David machte es zu Beginn seiner Amtszeit (~980 v. Chr.) zum „Königreich Juda“ (2 Sam 5,5 ), das er einige Jahre später mit den Gebieten weiterer israelitischer Stämme vereinte. Nach der Reichsteilung unter König Rehabeam umfasste das Südreich Juda auch das Gebiet des Stammes Benjamin (1 Kön 12,20f. ). Von da an nannte man Judas Bewohner Jehudi, gleich aus welchem Stamm sie kamen.[3]
Nach dem Untergang des Nordreichs Israel erweiterte sich die Bedeutung des Wortes. Das Buch Ester bezeichnet Mordechai aus dem Stamm Benjamin als „Jude“ (Est 2,5 ; 5,13 ) und seine vor einem Ausrottungsversuch gerettete Gruppe als „Volk“ und „die Juden“ (Est 8,12 ). Das Wort umfasste auch deren Religion und die Menschen, die sich ihr anschlossen (Est 8,17 ). So bezeichneten nun auch Nichtjuden im Achämenidenreich diese ethnische, politische und religiöse Minderheit. Dabei bezog sich Jehudi weiter auf die Bewohner der persischen Provinz Jehud, die Gebietsteile der früheren Reiche Israel und Juda umfasste. Juden nannten sich selbst vorwiegend außerhalb ihrer Herkunftsregion Jehudi, so der im Exil geborene, zum Hofbeamten des Perserkönigs aufgestiegene Jude Nehemia.[3]
Ioudaioi
Im Hellenismus (ab ~330 v. Chr.) wurde das schon etablierte hebräische Lehnwort Jehudi zu Ioudaioi („Judäer“) gräzisiert. So bezeichnen die Septuaginta und die Makkabäerbücher, später auch der jüdische Historiker Flavius Josephus und das Urchristentum die Israeliten. Das Synonym Israelites trat in diesen Texten zurück, doch der Name Israel blieb der übliche Sammelbegriff für dieses ethnisch-religiöse Kollektiv. In 1 Makk 8,18-32 verwendete Judas Makkabäus die Ausdrücke „Israel“, „das Volk der Judäer“ und „die Judäer“ gegenüber den Römern gleichsinnig für das zuvor unterdrückte, nun Roms Beistand suchende Volk, das er vertrat. Auch in 1 Makk 13,41-43 erscheinen die Worte „Israel“, „das Volk“ und „Judäer“ miteinander und synonym. Die Hasmonäer nannten ihr Königreich Ioudaia („Judäa“). Flavius Josephus sprach in seinen Antiquitates bis zum 11. Kapitel archaisierend vom „Volk der Israeliten“. Nachdem er deren Rückkehr aus dem Exil und die Restauration in der Perserzeit beschrieben hatte, nannte er sie ab dem 12. Kapitel immer „Judäer“, so auch in seinen übrigen Schriften. Das Wort umfasste bei ihm die Bewohner der nun römischen Provinzen Judäa und Samaria und Galiläa (Bellum Judaicum 1,21; 2,232). Die „Galiläer“ galten damals als Teil der Judäer (Contra Apionem 1,48) und wurden nur innerhalb dieses Volkes semantisch unterschieden. Simon Bar Kochba, der Anführer des letzten Aufstandes palästinischer Juden gegen die römische Besatzungsmacht (132–136), nannte sein Volk und dessen Land ausschließlich „Israel“; vielleicht, um sich von der römischen Provinz Judäa und deren jüdischen Vasallenkönigen abzugrenzen.[6]
Paulus von Tarsus nannte sich meist Ioudaios, so betont in Gal 2,15 gegenüber den „Sündern aus den Völkern“ (Gojim). In Röm 11,1 nannte er sich „Israelit aus dem Samen Abrahams, vom Stamm Benjamin“, in Röm 9,4.24 abwechselnd „Judäer“ und „Israelit“. Für Paulus waren dies also Synonyme, die alle auf das erwählte Bundesvolk verweisen. Die zeitweise übliche These, „Israeliten“ sei in der Antike eher die Selbstbezeichnung, „Judäer“ bzw. „Juden“ eher eine abfällige Fremdbezeichnung dieses Volkes gewesen, ist somit von damaligen Quellen nicht gedeckt.[7]
Wie das Wort Ioudaioi im NT angemessen zu übersetzen ist, wurde oft diskutiert.[8] Manche verstanden es ausschließlich geografisch als „Bewohner Judäas“, um diese von früheren Israeliten, damaligen Galiläern wie Jesus von Nazaret, späteren Juden und deren Religion abzurücken. Solche Versuche setzten sich in der Geschichtswissenschaft nicht durch. Das Wort Ioudaioi war damals vorwiegend ethnisch, nicht nur geografisch konnotiert, so dass „Judäer“ bzw. „Juden“ es zutreffend übersetzt.[9]
Im Römerreich wurde der Singular Ioudaios zu Iudaeus, der Plural Ioudaioi zu Iudaei latinisiert. Das Christentum verbreitete diese Bezeichnungen in ganz Europa.[3]
„Jüdisches Volk“
Im Anschluss an die biblische Tradition verstehen sich Juden oft als Teil des „jüdischen Volkes“. Juden aller Hautfarben, Nationalitäten, Kulturen und Lebensformen, auch nichtreligiöse Juden, zählen sich zu diesem Volk, definieren dieses Wort also weder rassisch oder genetisch noch nur ethnisch oder national noch nur als Religionszugehörigkeit. Sie beziehen sich dabei auf eine gemeinsame Geschichte, die eine Zusammengehörigkeit und Solidarität mit bedrohten und verfolgten Juden in anderen Teilen der Welt begründet. Die heiligen Schriften des Judentums stützen dieses Verständnis, indem sie jeden einzelnen Juden durch seinen Lebenswandel für die Gesamtheit aller Juden mitverantwortlich machen.[10]
Die Tora begründet diese Zusammengehörigkeit erzählerisch mit der gemeinsamen Abstammung aller Israeliten von den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob. Abrahams Berufung schließt laut Gen 12,1–3 die Erwählung seiner Nachkommen zum Segen für die Völker ein. Darauf beruht die biblische Bezeichnung der Israeliten als „Volk Gottes“ oder als „erwähltes Volk“. Diese Bezeichnung verstanden Nichtjuden oft als Arroganz und Hybris und nahmen sie zum Anlass, Juden abzuwerten und zu verachten. In der Bibel bedeutet Erwählung gerade Gottes Beschlagnahmung dieses Volkes dazu, diesen einzigen Schöpfer der Welt bekannt zu machen und ihm auf besondere Weise durch Erfüllen seiner Tora zu dienen, also sich seinem Befreiungswillen für diese Welt unterzuordnen.[11]
Der Bezug auf die gemeinsame Herkunft verbindet religiöse und säkulare Juden: „Von Zugehörigkeit zum Volk Israel […] kann man jedoch auch sprechen, wenn ein Individuum kulturell oder religiös von der religiös-kulturellen Wirklichkeit der Geschichte Israels in wesentlichen Bereichen seiner Persönlichkeit als geschichtliches Wesen faktisch geprägt ist und das positiv akzeptiert.“[12]
Antisemitisches Schimpfwort
In der langen Geschichte des Antisemitismus verknüpften Judenfeinde die Kollektivbezeichnung „die Juden“, auch verdichtet zum kollektiv gemeinten Singular „der Jude“, mit allen möglichen negativen Zuschreibungen und machten sie so zum Stigma und Mittel der Ausgrenzung. Juden sind im Glaubens- und Weltdeutungssystem von Antisemiten immer „die Anderen“, der ultimative Gegenentwurf zur eigenen Existenzform. Juden verkörpern für sie das prinzipiell Unnormale und Schlechte, das aus der eigenen Weltordnung auszuschließende Feindbild.[13] Dies hatte historisch die Vernichtung von mindestens sechs Millionen (mehr als einem Drittel aller damaligen) Juden in Europa durch NS-Deutschland im Holocaust zur Folge.[14]
Die Anrede „Du Jude“ wird bis heute als Schimpfwort verwendet, etwa auf Schulhöfen. Dies gilt in der Antisemitismusforschung als Wirkung und Fortsetzung des Antisemitismus.[15]
Der Duden erläuterte seinen Eintrag zum Wort „Jude“ jahrelang wie folgt:
„Gelegentlich wird die Bezeichnung Jude, Jüdin wegen der Erinnerung an den nationalsozialistischen Sprachgebrauch als diskriminierend empfunden. In diesen Fällen werden dann meist Formulierungen wie jüdische Menschen, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger oder Menschen jüdischen Glaubens gewählt.“[16]
2022 kritisierte ein deutscher Jude auf Twitter diese Erläuterung und löste damit eine breite Debatte aus. Teilnehmer verwiesen darauf, dass die Ersatzbezeichnung „Menschen jüdischen Glaubens“ falsch ist, da sie nichtreligiöse Juden ausschließt und die Nationalsozialisten nicht nur gläubige Juden verfolgten. Die Ersatzvorschläge seien ausgrenzend; der Duden wolle damit nur einem Unbehagen nichtjüdischer Deutscher genügen, die das Wort „Jude(n)“ an die Verbrechen ihrer Vorfahren erinnere. Die Bezeichnung sei keinesfalls diskriminierend, solange Juden selbst sie nicht so empfänden. Josef Schuster erklärte für den Zentralrat der Juden in Deutschland, das Wort sei für ihn „weder ein Schimpfwort noch diskriminierend“, wie schon der Name des Zentralrats zeige.[17] Auch Nichtjuden kritisierten den Dudenvorschlag als Kapitulation vor dem Missbrauch des Wortes durch Judenfeinde.[18] Daraufhin änderte die Dudenredaktion die Erläuterung des Stichworts wie folgt:
„Wegen des antisemitischen Gebrauchs in Geschichte und Gegenwart, besonders in der Zeit des Nationalsozialismus, werden die Wörter Jude/Jüdin seit Jahrzehnten von der Sprachgemeinschaft diskutiert. Gleichzeitig werden die Wörter weithin völlig selbstverständlich verwendet und nicht als problematisch empfunden. […] Besonders im öffentlichen Sprachgebrauch finden sich auch alternative Formulierungen wie jüdische Menschen, Bürger/-innen, Mitbürger/-innen oder – in religiösem Zusammenhang – Menschen jüdischen Glaubens. Eine weitere Variante ist ich bin jüdisch / er ist jüdisch.“[19]
Kennzeichen des Judeseins

Die Halacha ist das jüdische Recht, das bis 200 n. Chr. aus der mündlichen Tora-Auslegung der Rabbinen hervorging. Diese wurde in der Mischna und im Talmud gesammelt und schriftlich fixiert. Die Halacha definiert Juden nach zwei Kriterien: Jude oder Jüdin ist
- jedes Kind einer Mutter, die bei der Empfängnis selbst Jüdin nach der Halacha war (Matrilinearität),
- jede regelgerecht zum Judentum übergetretene Person (Konversion, hebräisch Gijur).
Kinder jüdischer Väter, die keine jüdische Mutter haben, müssen nach der Halacha zum Judentum übertreten, um als Juden zu gelten.[3] Die halachische Definition gilt unabhängig von der Herkunft der Person und unabhängig davon, ob oder wie sehr sie die Toragebote und sonstigen jüdischen Glaubensregeln befolgt oder nicht.[20]
Dieser Definition folgen im Grundsatz alle Hauptrichtungen des Judentums. Das Reformjudentum in den USA nimmt seit 1983 auch Kinder jüdischer Väter und nichtjüdischer Mütter auf, sofern diese jüdisch erzogen werden.[21]
Juden, die das Judentum aktiv praktizieren, beachten in der Regel einige Hauptgebote der Tora wie die Beschneidung, die Sabbat-Ruhe, Speise- und Reinheitsgebote und die jüdischen Hauptfeste. Die Jüdische Kultur ist jedoch vielfältig und umfasst ganz verschiedene Lebensweisen und Ausdrucksformen des Judeseins.
Die Israelische Unabhängigkeitserklärung definiert den heutigen Staat Israel als „Staat des jüdischen Volkes“ und gibt zugleich allen Staatsbürgern die gleichen Rechte, unabhängig von ihrer Religion oder Nationalität. Das Rückkehrgesetz von 1950 erlaubt jedem Juden und jeder Jüdin, in Israel einzuwandern und die Staatsangehörigkeit zu erwerben. Die Ausweisdokumente der Israelis enthalten Einträge nach Nationalität („le’om“) und Religionszugehörigkeit. Über letztere entscheiden die regionalen und lokalen, von orthodoxen Rabbinern besetzten Rabbinatsgerichte, damit verbunden auch über das Ehe- und Scheidungsrecht. Sie erkennen nur Nachkommen jüdischer Mütter und nach der Halacha zum Judentum übergetretene Menschen als Juden an. Diese Spannung zwischen orthodox-religiösem und staatlich-säkularem Verständnis von Judesein führte seit den 1950er Jahren immer wieder zu Konflikten. Nach Grundsatzurteilen des Obersten Gerichts wurden das Rückkehrgesetz und das Registrierungsgesetz mehrmals verändert. Seit 1970 können Personen mit einem jüdischen Großelternteil, im Ausland zum Judentum konvertierte Personen und deren Familienmitglieder sich als Juden nach der Nationalität eintragen lassen. Seit 2011 können unter Religion als „jüdisch“ eingetragene Personen den Eintrag auf „religionslos“ ändern lassen.[22]
Gruppen im Judentum
Zu den Juden gehören verschiedene, nach ihrer regionalen Herkunft zugeordnete Gruppen, darunter die Aschkenasim (europäische Juden), Mizrachim (orientalische Juden), Sephardim (osmanische und nordafrikanische Juden), Cochin-Juden (Südindien) und Falaschen (Äthiopien). Ein zum Judentum übergetretenes Volk waren die Chasaren. Eine jüdische Sondergruppe sind die Karäer. Hinzu kommen ethnische Gruppen, die sich als Juden verstehen, aber nach der Halacha nicht als solche anerkannt sind. Die in Israel geborenen Juden ordnen sich oft keiner spezifischen jüdischen Gruppe mehr zu.[23]
Demografie
Quellen
Das American Jewish Year Book veröffentlicht jährlich die von demografischen Instituten mehrerer Staaten gemeinsam ermittelten Gesamtzahlen der Juden weltweit und die Prozentzahlen ihrer Anteile an den Bevölkerungen einzelner Staaten. Zur jüdischen Kernbevölkerung zählen die Institute dabei nur Personen, die sich selbst nach Abstammung und Religion als Juden definieren und sich wechselseitig von anderen kollektiven Identitäten unterscheiden. Nicht mitgezählt sind Personen, die von Juden abstammen, aber einer anderen Religion folgen, und Nichtjuden mit familiären oder sonstigen Verbindungen zu Juden. Anerkannt ist, dass die strenge Definition eher zu niedrige Schätzungen hervorbringt, weil die Anteile von Juden mit mehreren kulturellen und religiösen Identitäten wachsen und dies die eindeutige Unterscheidung zwischen Juden und Nichtjuden zunehmend erschwert.[24]
Das Pew Research Center (PRC) legte seinen Statistiken für die USA bis 2020 eine weitere Definition von Judesein zugrunde: Es zählte auch Kinder von mindestens einem jüdischen Elternteil (also auch von jüdischen Vätern), Verwandte von Juden inklusive nichtjüdischer Familienangehöriger und Menschen dazu, die sich aus ethnischen, kulturellen oder anderen nichtreligiösen Gründen als Juden identifizieren. Für Israel folgte es den Kriterien des israelischen Rückkehrgesetzes für einreiseberechtigte Juden und deren Angehörige. So kam es für diese beiden Staaten zu höheren Gesamtzahlen. Dagegen definiert das israelische Central Bureau of Statistics jüdische Israelis nach der Halacha als Kinder jüdischer Mütter und von orthodoxen Gerichten anerkannte Konvertiten. 2024 übernahm das PRC wieder die strenge Definition, wonach nur Menschen dazu zählen, die sich selbst nach ihrer Religion ausschließlich als Juden definieren.[25]
Die folgenden Gesamtzahlen der Jewish Virtual Library (JVL) beginnen mit Schätzzahlen ab 1880 und beruhen ab 1922 auf genauen demografischen Studien. Ab 1945 bis derzeit 2024 beruhen die Zahlen auf den Statistiken des American Jewish Yearbook und der Berman Jewish Data Bank. Für Israel bezieht sich die JVL auf die Angaben des dortigen Central Bureau of Statistics. Zudem nennt ihre Statistik die aktuellen Bevölkerungsanteile der Juden in Einzelstaaten (Stand Oktober 2024).[26]
Gesamtzahlen
Alle Zahlen der folgenden Tabelle vor dem Komma sind Millionen. Die zweite Kommastelle ist in der Wiedergabe gerundet.
| Jahr | Zahl[26] |
|---|---|
| 1880 | 7,8 |
| 1900 | 10,6 |
| 1914 | 13,5 |
| 1922 | 14,4 |
| 1925 | 14,8 |
| 1931 | 15,7 |
| 1939 | 16,73 |
| 1945 | 11,0 |
| 1948 | 11,5 |
| 1950 | 11,3 |
| 1955 | 11,8 |
| 1960 | 12,08 |
| 1970 | 12,58 |
| 1980 | 12,82 |
| 1990 | 12,87 |
| 2000 | 13,25 |
| 2005 | 13,62 |
| 2010 | 14,05 |
| 2015 | 14,55 |
| 2018 | 14,60 |
| 2019 | 14,71 |
| 2020 | 15,08 |
| 2021 | 15,17 |
| 2022 | 15,25 |
| 2023 | 16,78 |
| 2024 | 17,14 |
Verteilung
Im Oktober 2024 lebten laut der JVL 41,7 % aller Juden weltweit in Israel, weitere 36,8 % in den USA, die übrigen 21,5 % verteilten sich vor allem auf 13 weitere Staaten. Bis dahin registrierten die Demografen laut JVL folgende absoluten Zahlen:
| Land | Zahl[26] |
|---|---|
| 7,15 Mio. | |
| 6,3 Mio. | |
| 438.500 | |
| 400.000 | |
| 313.000 | |
| 170.000 | |
| 125.000 | |
| 123.000 | |
| 117.000 | |
| 90.300 | |
| 49.500 | |
| 45.000 | |
| 41.000 | |
| 35.000 | |
| 32.000 |
Für weitere Staaten lagen 2021 folgende Zahlen vor:[27]
| Land | Zahl | Bevölkerungsanteil in % |
|---|---|---|
| 28.900 | 0,25 | |
| 27.200 | 0,05 | |
| 18.400 | 0,21 | |
| 16.400 | 0,47 | |
| 15.900 | 0,08 | |
| 14.900 | 0,14 | |
| 14.500 | 0,02 | |
| 12.900 | 0,03 | |
| 10.300 | 0,12 | |
| 10.000 | 0,23 |
Auf Regionen verteilten sich Juden im Jahr 2024 laut der JVL wie folgt:[26]
| Region | Zahl | Bevölkerungsanteil in % |
|---|---|---|
| Afrika | 54.600 | 0,004 |
| Asien | 7,8 Mio. | 0,17 |
| Europa | 1,3 Mio. | 0,16 |
| Ozeanien | 132.400 | 0,3 |
| Nordamerika | 6,72 Mio. | 1,79 |
| Zentralamerika | 58,500 | 0,03 |
| Südamerika | 302.100 | 0,07 |
Trends und Relationen
Seit dem Holocaust stieg die Gesamtzahl der Juden weltweit langsam und kontinuierlich wieder an und erreichte 2023 erstmals wieder annähernd das Niveau von 1939 (vor dem Zweiten Weltkrieg). Jedoch ging die Gesamtzahl der Juden in Europa und deren Anteil an der weltweiten Gesamtzahl seit 1945 kontinuierlich weiter zurück. Sie sank laut dem Pew Research Center (PRC) von 9,5 Mio. (57 %) im Jahr 1939 auf 1,1 Mio. (10 %) im Jahr 2010. Hauptgründe dafür waren die Auswanderung von Juden aus der früheren Sowjetunion und den früheren Ostblock-Staaten und der wachsende Antisemitismus im übrigen Europa.[28]
Von 2010 bis 2020 wuchs die jüdische Bevölkerung der Welt laut dem PRC insgesamt um weniger als eine Million (6 %), etwa halb so schnell wie die Weltbevölkerung insgesamt (12 %). Im gleichen Zeitraum wuchs die Zahl der Muslime weltweit von 1,7 auf 2,0 Milliarden (21 %). In Israel wuchs die Zahl der Juden prozentual weit stärker als in allen übrigen Staaten, nämlich jährlich um rund 100.000. Die allgemeine Geburtenrate von Müttern liegt dort seit Jahrzehnten stabil bei durchschnittlich drei Kindern. Anders als in den hundert Jahren zuvor übertraf die durchschnittliche Geburtenrate auch in der jüdischen Diaspora zuletzt die der umgebenden nichtjüdischen Gesellschaften. – Der führende Demograf Sergio Della Pergola prognostizierte im Juni 2025, erst in zehn bis zwanzig Jahren (2035–2045) werde die jüdische Bevölkerung in der Welt ihr volles Ausmaß vor dem Holocaust wiedererlangt haben; die meisten Juden würden künftig in Israel leben.[25]
Literatur
- Stefan Vennmann, Frank Lattrich: Jude. In: Bente Gießelmann, Robin Heun, Benjamin Kerst, Lenard Suermann, Fabian Virchow (Hrsg.): Handwörterbuch rechtsextremer Kampfbegriffe. Wochenschau Verlag, Schwalbach 2015, ISBN 978-3-7344-0155-8, S. 162–175
- Haim Hillel Ben-Sasson (Hrsg.): Geschichte des jüdischen Volkes. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 5. Auflage, Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-55918-1.
- Salcia Landmann: Wer sind die Juden? Geschichte und Anthropologie eines Volkes. dtv, München 1982, ISBN 3-423-00913-6.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ a b c Christian Frevel: Geschichte Israels. Kohlhammer, Stuttgart 2018, ISBN 978-3-17-035421-0, S. 28 f.
- ↑ Martina Böhm: Wer gehörte in hellenistisch-römischer Zeit zu „Israel“? In: Jörg Frey, Konrad Schmid, Ursula Schattner-Rieser (Hrsg.): Die Samaritaner und die Bibel / The Samaritans and the Bible. De Gruyter, Berlin / Boston 2012, ISBN 978-3-11-029409-5, S. 181–202, hier S. 189 ff.
- ↑ a b c d e Artikel Jew; Yehoshua M. Grintz: Semantics; Raphael Posner: Halakhic Definition. In: Encyclopaedia Judaica. 2. Auflage, Band 11. Thomson Gale, Detroit 2007, S. 253–255
- ↑ Martina Böhm: Wer gehörte in hellenistisch-römischer Zeit zu „Israel“? In: Jörg Frey, Konrad Schmid, Ursula Schattner-Rieser (Hrsg.): Die Samaritaner und die Bibel. Berlin / Boston 2012, S. 194 und Fn. 70.
- ↑ Albrecht Lohrbächer, Helmut Ruppel, Ingrid Schmidt (Hrsg.): Was Christen vom Judentum lernen können. Kohlhammer, Stuttgart 2006, ISBN 3-17-018133-5, S. 38.
- ↑ Wolfgang Stegemann: Jesus und seine Zeit. Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-012339-7, S. 193–196
- ↑ Wolfgang Stegemann: Jesus und seine Zeit. Stuttgart 2010, S. 197 f.
- ↑ John M. G. Barclay, Katherine M. Hockey, David G. Horrell (Hrsg.): Ἰουδαῖος: Ethnicity and Translation. In: Ethnicity, Race, Religion: Identities and Ideologies in Early Jewish and Christian Texts, and in Modern Biblical Interpretation. Bloomsbury Publishing, London 2018, ISBN 978-0-567-67731-0, S. 46–58; James D. G. Dunn: Jesus, Paul, and the Gospels. William B. Eerdmans, Grand Rapids (Michigan) 2011, ISBN 978-0-8028-6645-5, S. 124
- ↑ Wolfgang Stegemann: Jesus und seine Zeit. Stuttgart 2010, S. 189–192
- ↑ Jeffrey Wildstein: Judaism: An Introduction to Jewish Beliefs and History. DK-Publishing, New York 2015, ISBN 978-1-61564-782-8, S. 54 f.
- ↑ Jeffrey Wildstein: Judaism. New York 2015, S. 55 f.
- ↑ Ferdinand Dexinger: Judentum. In: Gerhard Müller (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie Band 17: Jesus Christus V – Katechismuspredigt. 4. Auflage. De Gruyter, Berlin 1988, ISBN 3-11-011506-9, S. 332.
- ↑ Monika Schwarz-Friesel, Jehuda Reinharz: Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert. De Gruyter, Berlin 2013, ISBN 978-3-11-055398-7, S. 47 f.
- ↑ Wolfgang Benz: Holocaust. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus: Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Band 3: Begriffe, Theorien, Ideologien. De Gruyter / Saur, Berlin 2011, S. 124
- ↑ Paula Maria Rüb: Der Umgang mit Antisemitismus im Unterricht: Eine qualitativ-rekonstruktive Studie zu Orientierungen von Lehrkräften. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2023, ISBN 978-3-7815-2552-8, S. 29.
- ↑ Björn Technau: Beleidigungswörter: Die Semantik und Pragmatik pejorativer Personenbezeichnungen. De Gruyter, Berlin 2018, ISBN 978-3-11-056091-6, S. 373, Fn. 94.
- ↑ Matthias Heine: Kaputte Wörter? Vom Umgang mit heikler Sprache. Duden-Verlag, Berlin 2022, ISBN 978-3-411-91402-9, S. 133 f.
- ↑ Duden ändert nach Kritik Hinweis zum Wort »Jude«. In: Jüdische Allgemeine. 16. Februar 2022.
- ↑ Duden – Das Synonymwörterbuch: Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter. Duden-Verlag, Berlin 2024, ISBN 978-3-411-91411-1, S. 529.
- ↑ Johann Maier: Jude, Judentum. In: Johann Maier: Judentum von A bis Z. Glauben, Geschichte, Kultur. Herder, Freiburg im Breisgau 2001, ISBN 3-451-05169-9, S. 235 f.
- ↑ Dana Evan Kaplan, Michael Berenbaum, Frecd Skolnik (Hrsg.): Reform Judaism. In: Encyclopaedia Judaica. 2. Auflage. Band 17. Macmillan, Detroit 2007, S. 172 f.
- ↑ Michael Brenner: Israel. Traum und Wirklichkeit des jüdischen Staates. Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68823-2, S. 144–153.
- ↑ Michael Brenner: Israel. München 2016, S. 220–231.
- ↑ Sergio DellaPergola: World Jewish Population, 2021. In: Arnold Dashefsky, Ira M. Sheskin (Hrsg.): The American Jewish Year Book, Band 121. Springer VS, New York 2021, S. 313–412; Volltext bei Berman Jewish Data Bank, PDF S. 11
- ↑ a b Rossella Tercatin: Muslims are world’s fastest-growing religious group; Jews far below pre-Holocaust numbers. Times of Israel, 9. Juni 2025
- ↑ a b c d Jewish Population of the World. Jewish Virtual Library, 2024 (Archivlink)
- ↑ Sergio DellaPergola: World Jewish Population, 2021. In: Arnold Dashefsky, Ira M. Sheskin (Hrsg.): The American Jewish Year Book. Band 121, New York 2021, PDF S. 27
- ↑ Michael Lipka: The continuing decline of Europe’s Jewish population. Pew Research Center, 9. Februar 2015
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colours. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed). See Flag of Australia.svg for main file information.
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
| Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
| Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
| Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
| Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
| Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
| Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Autor/Urheber: Fronl, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Orthodoxer Jude beim Gebet an der Klagemauer in Jerusalem, Israel