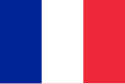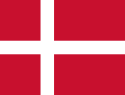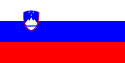Grenze zwischen Deutschland und Österreich


Die Grenze zwischen Deutschland und Österreich ist eine 815,9[1] bzw. 817 Kilometer[2] lange Staatsgrenze in Mitteleuropa. Sie trennt das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Norden und Westen von jenem der Republik Österreich im Süden und Osten. Für Österreich ist sie die längste Grenze zu einem Nachbarstaat, für Deutschland ist die Grenze zu Österreich gleichauf mit der Deutsch-Tschechischen Grenze ebenso die längste Landgrenze. Im Tiefenbereich des Obersees, eines Teils des Bodensees, ist der Grenzverlauf nicht eindeutig festgelegt.[3]
Auf österreichischer Seite der Grenze liegen die Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich, auf deutscher Seite der Freistaat Bayern (sowie mit ungeklärtem Grenzverlauf im Bodensee das Land Baden-Württemberg).
Abgesehen vom Bodensee wurde der aktuelle Grenzverlauf in einem bilateralen Staatsvertrag am 29. Februar 1972 rechtsverbindlich geregelt, nachdem bereits zuvor im 19. Jahrhundert diverse Grenzabkommen und -verträge zwischen Österreich und der Regierung des zu diesem Zeitpunkt souveränen Königreichs Bayern geschlossen worden waren.
Grenzverlauf
Im Westen beginnt der Grenzverlauf im Bodensee, wobei die exakte Grenzziehung auf dem Grund des Sees nach wie vor strittig bzw. schlichtweg rechtlich nicht normiert ist. Sowohl Deutschland als auch Österreich vertreten überwiegend die Kondominiumstheorie, der zufolge das Gebiet des „Hohen Sees“ (also ab einer Seetiefe von mehr 25 Metern) gemeinsam verwaltetes Gebiet aller Anrainerstaaten sei. Der dritte Bodenseeanrainerstaat, die Schweiz, geht allerdings von der Realteilungstheorie aus, der zufolge der See insgesamt anhand der Anteile an dessen Uferlinie auf die Anrainerstaaten aufzuteilen sei.[4] Gänzlich geklärt sind die Territorialfragen im Bodensee also nicht, bereiten in der Regel aber auch keine Probleme zwischen den partnerschaftlich agierenden Anrainerstaaten, die seit 1972 in der gemeinsamen Internationalen Bodenseekonferenz verbunden sind.[5]

Am südöstlichen Teil des Bodensees beginnt die Landgrenze zwischen Deutschland und Österreich bei Lindau (D) beziehungsweise Hörbranz (A), wobei diese zunächst im Flussbett des Bodenseezuflusses Leiblach verläuft. Über diesen Grenzfluss führt auch die Autobahn-Grenzbrücke zwischen der deutschen Bundesautobahn 96 und der österreichischen Rheintal/Walgau Autobahn A 14. Der Grenzverlauf folgt ostwärts mehreren Flüssen und Bächen durch die hügelige Landschaft des bayerischen Allgäu an der Grenze zum Vorarlberger Vorderwald. Schließlich erreicht sie die Gipfel der Allgäuer Nagelfluh-Schichtkämme und bildet damit eine geografische Besonderheit: Das Tal der Breitach schneidet sich südlich der Breitachklamm als Kleinwalsertal in dieses Gebirgsmassiv und ist daher rundherum von hohen Bergen umgeben. Politisch gehört die einzige Gemeinde im Kleinwalsertal, Mittelberg, zum österreichischen Bundesland Vorarlberg. Diese ist jedoch als Funktionale Enklave durch ihre Lage nur über deutsches Staatsgebiet erreichbar.
Östlich des Kleinwalsertals steigen die Berge noch steiler an. Die Staatsgrenze erreicht die innerstaatliche Grenze zwischen den österreichischen Bundesländern Vorarlberg und Tirol. Dieser als Haldenwanger Eck bezeichnete Punkt ist nicht nur die Grenze zwischen den beiden österreichischen Bundesländern, sondern auch der südlichste Punkt des deutschen Staatsgebiets. Die Grenze folgt von hier dem zentralen Hauptkamm der Allgäuer Alpen nach Nordosten bis zu den Tannheimer Bergen. Mit der Tiroler Gemeinde Jungholz, die nur über einen Punkt nahe dem Gipfel des Sorgschrofens mit dem restlichen Staatsgebiet verbunden ist, existiert in diesem Bereich eine weitere funktionale Enklave in Deutschland. Von dort verläuft die Grenze Richtung Osten entlang dem Zirmgrat und quer durch die Ammergauer Alpen. Kurz danach erreicht sie im Wettersteingebirge die höchsten Punkte des Grenzverlaufs. Die Zugspitze, der höchste Berg Deutschlands, bildet dabei mit ihrer Höhe von 2962 m ü. NHN einen der markantesten Grenzpunkte und den höchsten Punkt der gemeinsamen Staatsgrenze. Über mehrere Gipfel der Nördlichen Karwendelkette, durch das Vorkarwendel und die Bayerischen Voralpen verläuft die Grenze in der Folge ostwärts als Nordgrenze Tirols.
Bei Kufstein (A) beziehungsweise Kiefersfelden (D) trifft der Grenzverlauf auf das Unterinntal. In diesem verläuft eine der verkehrstechnisch wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Mitteleuropas. Zum einen befindet sich hier ein Autobahngrenzübergang im Verlauf der österreichischen Inntalautobahn A 12 und der deutschen Bundesautobahn 93, die im weiteren Verlauf über die Brenner Autobahn und den Brennerpass Deutschland mit Italien verbindet und eine wichtige Transitstrecke darstellt. Außerdem verläuft parallel dazu auch die Bahnstrecke Kufstein–Innsbruck bzw. Rosenheim–Kufstein Grenze durch das Unterinntal, über die weite Teile des Nord-Süd-Bahnverkehrs sowie der überwiegende Teil des innerösterreichischen Bahnverkehrs zwischen Tirol und den östlicheren Bundesländern geführt wird. Für einige Kilometer verläuft die Grenze hier erstmals im Flussbett des Inn, ehe der Grenzverlauf bei Erl ostwärts vom Flusslauf abzweigt und damit das sogenannte Große Deutsche Eck, ein markanter südöstlicher Einschnitt im österreichischen Staatsgebiet zwischen Tirol und Salzburg, beginnt. Den südlichsten Punkt erreicht das „Deutsche Eck“ südlich des Königssees im Landkreis Berchtesgadener Land.

Anschließend wendet sich der Grenzverlauf wieder nordöstlich und erreicht das Stadtgebiet der Landeshauptstadt Salzburg, wo die Grenze über den Walserberg verläuft und anschließend auf den Grenzfluss Saalach trifft, der sie dann bis zur Einmündung in die Salzach bei Freilassing folgt. Die Salzach wiederum bildet die gemeinsame Grenze zwischen den Bundesländern Salzburg bzw. wenig später Oberösterreich und Bayern bis zur Einmündung in den Inn bei Haiming. Bei Passau weicht der Grenzverlauf kurzzeitig südlich vom Flusslauf des Inns ab, wodurch die Einmündung des Inns in die Donau keinen Grenzpunkt darstellt und sich in diesem Bereich einige Quadratkilometer deutschen Staatsgebiets südlich der Inn-Donau-Linie befinden.
Ab dem Ortsteil Achleiten der österreichischen Gemeinde Freinberg (dort befindet sich der Grenzstein Nr. 1 der Republik Österreich auf dem Kräutelstein, einer kleinen Felseninsel in der Donau) liegt die Grenze in der Flussmitte der Donau und verlässt diese erst wieder bei Engelhartszell, wo sich der Grenzverlauf nochmals nach Nordosten vom Fluss wegbewegt. Er folgt in diesem Bereich Richtung Böhmerwald mehreren kleineren Bächen und trifft schließlich etwa 25 Kilometer von der Donau entfernt bei Schwarzenberg am Böhmerwald auf die Dreieckmark. Dieser Grenzstein nahe dem Bayerischen Plöckenstein markiert das Dreiländereck von Deutschland, Österreich und Tschechien und damit das östliche Ende der deutsch-österreichischen Grenze.
Gemeinden an der Staatsgrenze (von Ost nach West)
Legende: ![]() Grenzübertritt möglich: es sind nur Stellen angegeben, an der die Grenze mit PKW, Eisenbahn, Fähre oder Passagierschiff überquert werden können.
Grenzübertritt möglich: es sind nur Stellen angegeben, an der die Grenze mit PKW, Eisenbahn, Fähre oder Passagierschiff überquert werden können.
- Legende
- 1=Schwarzenberger Gegenbach
- 2=Große Mühl
- 3=Finsterbach
- 4=Grenzbach/Osterbach
- 5=Ranna
- 6=Rannasee
- 7=Schindelbach
- 8=Lindenbach
- 9=Stöcklbach
- 10=Dandlbach
- 11=Pittenbach
- 12=Seeache
- 13=Rickenbach
- 14=Leiblach
- A=Berchtesgadener Alpen
- B=Chiemgauer Alpen
- C=Bayrische Voralpen
- D=Karwendel
- E=Wettersteingebirge und Mieminger Kette
- F=Ammergauer Alpen
- G=Allgäuer Alpen
Grenzübertritt und Grenzverkehr
An der deutsch-österreichischen Grenze gibt es mehr als 50 Grenzübergänge, die ein Passieren der Grenze im Rahmen des motorisierten Individualverkehrs oder mittels öffentlicher Nah- und Fernverkehrstransportmittel (zum Beispiel Zügen, Linienschiffen auf dem Bodensee und Seilbahnen) ermöglichen. Geografisch bedingt befinden sich die meisten dieser Grenzübergänge im östlichen, flacheren Teil der Grenze ab Salzburg. Gerade die im westlichen Teil gelegenen hochrangigen Straßenverbindungen zählen wegen ihrer Bedeutung für den Nord-Süd-Transit und den Urlauberreiseverkehr zu den wichtigsten Grenzübergängen. So stellt etwa der Autobahngrenzübergang Kufstein/Kiefersfelden im Unterinntal als Teil der deutschen Bundesautobahn 93 bzw. der österreichischen Inntalautobahn A 12 einen wichtigen Teil der Nord-Süd-Verbindung von Deutschland über den österreichisch-italienischen Brennerpass in die norditalienischen Industrie- und Tourismusregionen sowie weiter ins Landesinnere Italiens dar. Eine ähnliche Funktion, hauptsächlich für den Touristenverkehr, erfüllt der gänzlich in Österreich gelegene Fernpass, der von der Grenze aus durch den Grenztunnel Füssen erreicht werden kann und den Verkehr in Richtung des österreichisch-italienischen Reschenpass bzw. des Brennerpass leitet. Diese Alpenquerungen entlang der deutsch-österreichischen Grenze tragen neben den weiter südöstlich gelegenen innerösterreichischen Querungen – etwa durch die Tauern Autobahn und die Pyhrn Autobahn – die Hauptlast des Reise- und Gütertransportverkehrs durch die Ostalpen.[6]

Besonders für den innerösterreichischen Verkehr bedeutsam sind die Autobahngrenzübergänge Kufstein/Kiefersfelden an der Inntal Autobahn und Salzburg-Walserberg am Beginn der West Autobahn A 1. Diese beiden Grenzübergänge stellen gemeinsam mit den dazwischen liegenden deutschen Autobahnstücken der A 8 bis zum Autobahndreieck Inntal und der Bundesautobahn 93 die Hauptverkehrsachse zwischen Ost- und Westösterreich dar. Eine direkte Autobahnverbindung auf österreichischem Territorium zwischen Tirol und den östlicheren Bundesländern existiert nicht. Ähnlich verhält es sich mit der Rosenheimer Schleife. Sie verbindet die Bahnstrecken zwischen Kufstein/Kiefersfelden und Freilassing/Salzburg über das Deutsche Eck. Diese stellt, auf deutschem Staatsgebiet gelegen, die wichtigste Schienenverbindung zwischen Ost- und Westösterreich dar und hat eine entsprechende Bedeutung sowohl für den innerösterreichischen als auch internationalen Personen- und Güterverkehr. Der Grenzübergang über die Saalachbrücke zwischen den Stationen von Freilassing und Salzburg ist Teil der Magistrale für Europa, einem EU-Projekt zur Schaffung einer Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Paris und Budapest.
 – BAB 3 nach dem österreichisch-deutschen Grenzübergang Suben/Passau bei Pocking
– BAB 3 nach dem österreichisch-deutschen Grenzübergang Suben/Passau bei PockingDa Deutschland zu den Gründungsmitgliedern und Vollanwendern des Schengener Abkommens seit 1990 gehört und Österreich das Abkommen nach seinem EU-Beitritt 1995 ab 1. Dezember 1997 ebenfalls in Vollanwendung hat, finden an den Grenzen keine regulären Personenkontrollen mehr statt. Fallweise, etwa während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, wurde das Schengener Abkommen durch Deutschland oder Österreich temporär ausgesetzt, um Grenzkontrollen durchführen zu können. Nach dem Beginn der Flüchtlingskrise in Europa begann die deutsche Bundespolizei im September 2015 an einigen Grenzübertrittsstellen stichprobenartige Kontrollen.[7]
Während der Corona-Pandemie in Deutschland und in Österreich war ab März 2020 die Grenze zeitweise fast vollständig geschlossen und die Einreise von Österreich nach Deutschland nur noch für Bürger mit Wohnsitz in Deutschland und Warenverkehr möglich. Des Weiteren musste während der Corona-Pandemie zeitweise ein entsprechender Impf- bzw. Testnachweis den Grenzschutzbeamten zur Einreise vorgelegt werden.
Siehe auch
Literatur
- Daniel-Erasmus Khan: Die deutschen Staatsgrenzen: rechtshistorische Grundlagen und offene Rechtsfragen (= Ius publicum. Band 114). Mohr Siebeck, Tübingen 2004, ISBN 3-16-148403-7, Kap. II: Die deutsch-österreichische Grenze, S. 164–232.
Weblinks
- Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über die gemeinsame Staatsgrenze im Rechtsinformationssystem des Bundes
Einzelnachweise
- ↑ Artikel Staatsgrenzen. In: Ernst Bruckmüller: Österreich-Lexikon. Verlagsgemeinschaft Österreich-Lexikon, Wien 2004.
- ↑ Gemeinsame Grenzen Deutschlands mit den Anliegerstaaten. Statistisches Bundesamt, 31. Dezember 2015, abgerufen am 1. Juli 2019.
- ↑ Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern (Memento des vom 18. Februar 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF).
- ↑ Claudius Graf-Schelling: Die Hoheitsverhältnisse am Bodensee unter besonderer Berücksichtigung der Schiffahrt. Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1978, ISBN 3-7255-1914-5.
- ↑ Ulrich Nachbaur: Vorarlberger Territorialfragen 1945 bis 1948. Ein Beitrag zur Geschichte der Vorarlberger Landesgrenzen seit 1805 (= Vorarlberger Landesarchiv [Hrsg.]: Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs. Band 8 (N.F.)). UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz 2007, ISBN 978-3-89669-629-8, Kapitel 12.7. „Wem gehört der Bodensee?“, S. 262–295 (Als PDF abrufbar im Webauftritt des Vorarlberger Landesarchivs).
- ↑ Elisabeth Lichtenberger: Geopolitische Lage und Transitfunktion Österreichs in Europa. Hrsg.: Österreichische Akademie der Wissenschaften. Kommission für die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Dienststellen des Bundesministeriums für Landesverteidigung. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1999, ISBN 3-7001-2801-0, S. 35 (Online [PDF; 2,9 MB; abgerufen am 3. November 2021]).
- ↑ Deutschland führt vorübergehend Grenzkontrollen ein. In: Spiegel Online. 13. September 2015, abgerufen am 13. September 2015.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Sign of motorway A8 in Austria
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Wappen Landkreis Freyung-Grafenau. Über gekürzter und eingeschweifter Spitze, darin die bayerischen Rauten, in Silber nebeneinander ein linksgewendeter schwarzer Bär und ein roter Wolf. Die früheren Kreise Grafenau und Wolfstein wurden 1972 zum neuen Landkreis Freyung-Grafenau vereinigt. Das Amt Wolfstein, benannt nach dem Schloss Wolfstein nahe Freyung, geht zurück auf ein bischöflich passauisches Pflegamt. Deshalb steht das Passauer Wappenschild, der rote Wolf, im Landkreiswappen; er war schon im früheren Wolfsteiner Kreiswappen berücksichtigt worden. Das Amt Grafenau, das aus dem herzoglich bayerischen Pfleggericht Bärnstein bei Grafenau hervorgegangen ist, wird im Wappen durch den Bären symbolisiert. Die bayerischen Rauten zeigen die lange Kontinuität bayerischer Verwaltungstradition im unteren bayerischen Wald. Sie standen auch schon im früheren Grafenauer Landkreiswappen.
Blasonierung:„In Rot eine gezinnte silberne (weiße) Stadtmauer, deren Seitenteile perspektivisch zurücktreten und in deren Mittelteil sich ein Stadttor mit offenen Torflügeln und hochgezogenem Fallgatter befindet; hinter der Stadtmauer ein sechseckiger silberner (weißwer) Turm mit goldenem (gelbem) Dach, flankiert von zwei schmaleren, niedrigeren, gezinnten silbernen (weißen) Rundtürmen mit goldenen (gelben) Spitzdächern.“
Das Wappen wurde der Stadtgemeinde zuletzt am 14. November 1931 verliehen. Die älteste erhaltene Darstellung des Salzburger Stadtwappens, auf einem Stadtsiegel, stammt aus dem Jahr 1249 und fand in dieser Form bis ins 15. Jahrhundert Verwendung. Das heutige Stadtwappen ist eine Weiterentwicklung des später entstandenen spätgotischen Stadtsiegeltyps. Wurde bis vor etlichen Jahren ein detailreiches Wappen verwendet, so ist heute ein stark stilisiertes gebräuchlich.
Wappen der österreichischen Stadt Kufstein
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik, vom 1. Oktober 1959 bis 3. Oktober 1990
Blasonierung:„Im goldenen (gelben) Schild auf grünem Dreiberg drei grüne Salweiden, deren mittlere höher ist als die beiden äußeren.“
Das Wappen wurde der Stadtgemeinde zuletzt am 3. April 1928 verliehen. Die drei Salweiden auf den drei Hügeln, sind "redend". Hier leitet der Heraldiker "Saalfelden" von "Salweide" ab. Erstmals erschienen die Symbole auf einer Wappenrolle von 1620. Vermutlich wurde das Wappen schon 1516 mit dem Erlangen der Marktrechte offiziell verliehen.
Hittisau, Vorarlberg: In einem blauen Schilde erhebt sich hinter einem nach rechts ansteigenden Rasenboden – zur Linken durch eine Wasserfläche in Form eines Ständers getrennt – ein unten beraster, oben bewaldeter Berg, hinter dem am rechten Schildesrande ein weiterer, durchwegs beraster Berg zu sehen ist. Auf dem Rasenboden steht am rechten Endpunkte der Wasserfläche eine hohe Tanne. Den Schild umgibt eine ornamentierte bronzefarbige Randeinfassung. (Verleihung: 2. Dezember 1930)
Wappen der Gemeinde Antiesenhofen in Österreich
Wappen der Gemeinde Mittelberg, Vorarlberg
„Ein blauer Schild, aus dessen Grunde sich ein Felsen erhebt, auf dem ein aufgerichteter, natürlicher Steinbock steht; hinter dem Felsen ist ein hoher, spitz zusammenlaufender grüner Bergkegel zu sehen. Felsen und Bergkegel sind mit Legföhren bewachsen. Den Schild umgibt eine bronzefarbene ornamentierte Randeinfassung.“
Blasonierung:„In Silber (Weiß) drei sich mit den Schwänzen berührende schwarze Zobel, in Form einer Triskele.“
Das Wappen wurde der Gemeinde von der Tiroler Landesregierung am 20. Oktober 1987 verliehen. Das Wappen ist "redend". Zöblen ist von Zobel abgeleitet.
Coat of arms of Maria Alm am Steinernen Meer, Salzburg
Blasonierung:„In Grün, vorn eine silberne (weiße) Flanke im Wellenschnitt; hinten ein steigendes silbernes (weißes) Einhorn.“
Das Wappen wurde der Gemeinde von der Tiroler Landesregierung am 11. September 1979 verliehen. Das senkrecht verlaufende silberne Wellenfeld stellt den Gemeindenamen dar ("Redendes Wappen"). Das Einhorn deutet auf die einstige Zugehörigkeit zum Gericht Aschau hin, welches dieses Symbol im Schild führte.
Wappen der Gemeinde Eben am Achensee, Tirol
Dieses Werk ist gemäß dem Österreichischen Urheberrechtsgesetz gemeinfrei, da es Teil eines durch die Österreichische Bundesregierung oder einer Landesbehörde veröffentlichen Gesetzes, Verordnung oder offiziellen Dekrets ist, oder weil dieses Werk von vorwiegend offizieller Verwendung ist. (§7 UrhG)
Hinweis zum Hochladen: Falls vorhanden, bitte Erstveröffentlichung und Dokumentquelle angeben.
Wappen von Oberaudorf
Source: "Fahnen-Gärtner GmbH, Mittersill"

|
Dieses Werk stellt eine Flagge, ein Wappen, ein Siegel oder ein anderes offizielles Insigne dar. Die Verwendung solcher Symbole ist in manchen Ländern beschränkt. Diese Beschränkungen sind unabhängig von dem hier beschriebenen Urheberrechtsstatus. |
Wappen der Gemeinde Wals-Siezenheim, Land Salzburg,
In Blau ein langgestreckter weißer Berg (Untersberg) und davor auf grünem Boden ein natürlicher, grüner, gelbbefruchteter Birnbaum.
Wappen der Gemeinde Sankt Georgen bei Salzburg, Land Salzburg
Wappen von Burgkirchen an der Alz; „In Blau eine silberne Retorte auf goldenem Dreibein, darüber waagrecht schwebend ein goldenes Sensenblatt.“
Gemeinde Werfen: Im geteilten Schild oben in Gold die wachsende vorwärtsgekehrte Gestalt eines Pilgers mit rotem Kleide, schwarzem Mantel und ebensolchem barettartigem Hut, in der Rechten einen Pilgerstab haltend, die Linke in die Seite gestützt, unten in Blau ein aufrechter rechtsgewendeter schwarzer Hund
Wappen von Vils
Flag-map of Austria
Wappen der Tiroler Gemeinde Ehrwald (AT): Ein fünfreihig silbern-grün gespickelter Schild.
Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien, in der Nähe von Dreisesselberg und Plöckenstein
Cyan check mark (✓) icon on a transparent background. Slight gradient between "Green30" (#14866D) and "Green50" (#00AF89)
Source: "Fahnen-Gärtner GmbH, Mittersill"

|
Dieses Werk stellt eine Flagge, ein Wappen, ein Siegel oder ein anderes offizielles Insigne dar. Die Verwendung solcher Symbole ist in manchen Ländern beschränkt. Diese Beschränkungen sind unabhängig von dem hier beschriebenen Urheberrechtsstatus. |
Blasonierung:„In Schwarz über einem rotem Baumstumpf eine springende silberne (weiße) Gämse.“
Das Wappen wurde der Gemeinde von der Tiroler Landesregierung am 15. Juli 1981 verliehen. Die Gämse ist ein Zeichen für ein mittelalterliches Privileg, welche den Gränern erlaubte jährlich einige von ihnen zu jagen; ab 1650 durften auch Waffen dafür eingesetzt werden. Der Baumstumpf ist "redend". Grän stammt von "Geröne", was soviel wie gerodete Fläche bedeutet.
Gemeinde Unken: Schrägrechtsgeteilter Schild; oben in Gold aus der Teilung ragend auf roter Quermauer ein roter Torbau mit zwei Blindfenstern; unten in Schwarz ein schrägrechtes goldenes Posthorn mit linksgerichtetem Mundstück, schwarzgoldener Umschnürung samt ebensolchen zwei Quasten.
Hörbranz, Vorarlberg: Ein goldener, von einem roten mit einem silbernen Schwerte mit goldenem Griffe belegten Schrägrechtsbalken durchzogener Schild. Den Schild umgibt eine ornamentierte bronzefarbige Randeinfassung. (Verleihung: 28. Oktober 1935)
Hohenweiler, Vorarlberg: Ein geteilter Schild. Die obere Hälfte ist in drei Reihen zu je sechs Plätzen von Rot und Silber geschacht; das untere rote Feld wird von einem silbernen Balken durchzogen. Den Schild umgibt eine ornamentierte bronzefarbige Randeinfassung. (Verleihung: 10. April 1929)
Autor/Urheber: Slevon28, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Map from: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Germany-Outline.svg
Flag from:
File:Flag_of_Germany.svgAutor/Urheber: Eweht, Lizenz: CC0
Markierung der Staatsgrenze zwischen Österreich und Deutschland auf dem Belag des Europastegs zwischen Oberndorf bei Salzburg und Laufen.
Coat of arms of Schärding, Austria.
Blasonierung:„In Rot über einem aus dem Schildfuß wachsenden silbernen (weißen) Schrannentisch zwei gekreuzte silberne (weiße) und goldene (gelbe) Schlüssel.“ Offiziell lautet die Blasonierung:„In rotem Schild aufwärtsgekreuzt ein goldener und ein silberner Schlüssel über einem aufragenden steinernen Schrannentisch.“
Das Wappen wurde der Gemeinde von der Salzburger Landesregierung am 9. August 1972 verliehen. Der sogenannte Schrannentisch steht als Zeichen für den früheren Gerichtsort Anthering, an dem über 100 Jahre Recht gesprochen wurde. Die Schlüssel stellen den Bezug zur Fürstpropostei Berchtesgaden her, zu der die Gemeinde früher gehörte.
Dieses Werk ist gemäß dem Österreichischen Urheberrechtsgesetz gemeinfrei, da es Teil eines durch die Österreichische Bundesregierung oder einer Landesbehörde veröffentlichen Gesetzes, Verordnung oder offiziellen Dekrets ist, oder weil dieses Werk von vorwiegend offizieller Verwendung ist. (§7 UrhG)
Hinweis zum Hochladen: Falls vorhanden, bitte Erstveröffentlichung und Dokumentquelle angeben.
Mit dem goldenen Legföhrenzweig auf grünem Grund im Wappen der Gemeinde Wildermieming wird die Bedeutung dieser Pflanze als Schutz für den Ort Wildermieming vor Muren gewürdigt.
Dieses Werk ist gemäß dem Österreichischen Urheberrechtsgesetz gemeinfrei, da es Teil eines durch die Österreichische Bundesregierung oder einer Landesbehörde veröffentlichen Gesetzes, Verordnung oder offiziellen Dekrets ist, oder weil dieses Werk von vorwiegend offizieller Verwendung ist. (§7 UrhG)
Hinweis zum Hochladen: Falls vorhanden, bitte Erstveröffentlichung und Dokumentquelle angeben.
Blasonierung:„In Rot ein silberner (weißer) Balken, darüber über einem gleichhohen grünen Dreiberg, drei grüne Tannen mit naturfarbenen Stämmen.“
Das Wappen wurde der Marktgemeinde bereits 1664 verliehen. Die drei Tannen auf den drei Hügeln, steht für den Waldreichtum der Region und den Ursprung des Namens Reutte, der sich von „roden“ abgeleitet hat ("Redendes Wappen"). Die drei Hügel stehen für die Landschaft; die rot-weiß-roten Streifen zeigen die Zugehörigkeit zu Tirol und Österreich.
Blasonierung:„In Silber (Weiß) eine grüne Tanne, am linken Schildrand zwei rote Stäbe (Pfähle).“
Das Wappen wurde der Gemeinde von der Tiroler Landesregierung am 8. Mai 1984 verliehen. Die Tanne ist "redend". Die Farben Österreichs erinnern daran, dass die Herzöge von Österreich als Tiroler Landesfürsten um die Wende zur Neuzeit das ganze Tannheimer Tal erworben und als Anwaltschaft mit Tannheim als Hauptort zu einem Bestandteil des Tiroler Gerichtes Ehrenberg gemacht haben.
Wappen des Markts Garmisch-Partenkirchen in Bayern; nicht zu verwechsln mit dem ähnlichen Wappen der Marktgemeinde Telfs in Tirol
Autor/Urheber: Wolfgang Stanglmeier, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Der Grenzstein 147 steht am südlichsten Punkt Deutschlands an der Grenze zu den österreichischen Bundesländern Vorarlberg und Tirol. Im Hintergrund ist jenseits des oberen Endes des Haldenwanger Tales das Geißhorn zu sehen.
Blasonierung:„In goldenem (gelbem) Schild ein grüner Dreiberg, auf dessen Mittelkuppe ruhend ein achtspeichiges rotes Wagenrad.“
Das Wappen wurde der Gemeinde von der Salzburger Landesregierung am 8. Oktober 1970 verliehen. Die Berge stellen die drei höchsten Erhebungen Bergheims dar (Hochgitzen, Plainberg und Voggenberg); es ist gleichzeitig "redend". Das Wagenrad weist auf die früheren Herren von Radeck hin.
© Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Grenzkontrolle auf der BAB 3 nach dem österreichisch-deutschen Grenzübergang Passau bei Pocking
Wappen der Gemeinde Hinterhornbach, Tirol
Wappen von Nußdorf am Haunsberg im Salzburg im Bezirk Salzburg-Umgebung in Österreich.
korrektes Wappen der Marktgemeinde Ostermiething
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Reliefkarte des Grenzverlaufes zwischen Deutschland und Österreich
Blasonierung:„In Silber (Weiß) ein rechtsgerichteter roter Adlerflügel, belegt mit einem langstieligen goldenen (gelben) Kleeblatt; vorn aus dem Flügel wachsend ein siebenblättriger grüner Zweig.“
Das Wappen wurde der Gemeinde von der Tiroler Landesregierung am 28. Februar 1978 verliehen. Das Wappen zeigt einen Flügel des Tiroler Adlers, als Zeichen der Zugehörigkeit der Enklave zu Tirol, aus dem "redend" ein Sprössling ("junges Holz") wächst.
Autor/Urheber: Austriantraveler, Lizenz: CC BY-SA 3.0
ehemalige Grenzstation an der deutsch-österreichischen Grenze zwischen Hörbranz und Lindau-Zech
Blasonierung:„Schräglinksgeteilt, nach vorn verschoben in Silber (Weiß); links der Teilungslinie in drei Reihen 15, gespaltene Tannen in Grün und Schwarz.“
Das Wappen wurde der Gemeinde von der Tiroler Landesregierung am 16. Oktober 1990 verliehen. Das Wappen ist "redend"; es zeigt einen "schattigen Wald" oder "Tannen im Schatten".
Wappen von Engelhartszell, Oberösterreich, Österreich
Wappen der Gemeinde Walchsee, Tirol