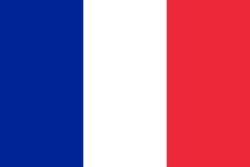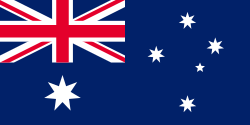Ernst Ihbe
Hermann Ernst Ihbe (* 20. Dezember 1913 in Erlbach, Vogtland; † 30. August 1992 in Markranstädt) war ein deutscher Radrennfahrer. 1936 wurde er Olympiasieger mit dem Tandem.
Sportliche Laufbahn
Ernst Ihbe war gelernter Drogist. Er startete für den R.C. Wettiner in Leipzig. Nach einigen guten Erfolgen wurde er 1933 in die von Willi Frenzel begründete Deutsche Nationalmannschaft Bahn berufen, obwohl er krankheitsbedingt einige Auswahlrennen nicht bestreiten konnte.[1] Ab 1934 bildete er zusammen mit Carl Lorenz ein Tandem. Bei den Offenen Britischen Meisterschaften 1934 fuhr in der ersten Runde Lorenz auf der vorderen Position, aber die beiden unterlagen. Im Hoffnungslauf wechselte Ihbe nach vorn, und da die beiden nicht nur den Hoffnungslauf, sondern auch die britische Meisterschaft gewannen, blieb Ihbe bis zum Ende der gemeinsamen Karriere der Vordermann. Die beiden Sportler gewannen gemeinsam zwei deutsche Meistertitel, Ihbe war zusätzlich einmal Deutscher Meister über 25 Kilometer im Bahnradsport. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin gewannen Ihbe und Lorenz gemeinsam die Goldmedaille im Tandemrennen. Bereits 1933 gewann er seinen ersten Titel als Deutscher Meister, er siegte im 25 Kilometerrennen. Im September wurde er zu seinem ersten Auslandsstart (Kopenhagen) berufen. Nachdem er 1934 den nationalen Tandemtitel mit Lorenz gewonnen hatte, siegte er auch 1935 (diesmal mit Rudolf Karsch) und 1937 (ebenfalls mit Karsch). Das Rennen wurde über die ungewöhnliche Distanz von 5000 Metern mit Punktwertung ausgetragen.[1]
Seine Einberufung zum Militär unterbrach seine Laufbahn von 1939 bis 1945. Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft versuchte sich Ihbe 1945 ohne größere Erfolge als Profi.
Berufliches
Er war später Radsporttrainer bei verschiedenen Vereinen in Leipzig, wo er u. a. beim SC Rotation Leipzig Wolfgang Tertschek und Erhard Pesch zu DDR-Meistertiteln führte. Ab 1965 war er Bezirkstrainer in Halle. In dieser Eigenschaft betreute er unter anderem mehrere Jahre den späteren Weltmeister Axel Grosser und den späteren Olympiasieger Klaus-Jürgen Grünke, bis dieser mit 19 Jahren nach Berlin wechselte. Als in der DDR Anfang der 1950er Jahre ein Verbot des Berufsradsports diskutiert wurde, sprach sich Ihbe öffentlich dagegen aus.[2]
Literatur
- Volker Kluge: Olympische Sommerspiele. Die Chronik I. Athen 1896 – Berlin 1936. Sportverlag Berlin, Berlin 1997, ISBN 3-328-00715-6.
Weblinks
- Ernst Ihbe in der Datenbank von Radsportseiten.com
- Ernst Ihbe in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ a b Express-Verlag (Hrsg.): Illustrierter Radsportexpress. Nr. 6. Berlin 1949, S. 42.
- ↑ Illustrierter Radrennsport. Nr. 11/1950. Berlin 1950, S. 9.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Ihbe, Ernst |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Radrennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 20. Dezember 1913 |
| GEBURTSORT | Erlbach |
| STERBEDATUM | 30. August 1992 |
| STERBEORT | Markranstädt |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
National- und Handelsflagge des Deutschen Reiches von 1935 bis 1945, zugleich Gösch der Kriegsschiffe.
Das Hakenkreuz ist im Vergleich zur Parteiflagge der NSDAP um 1/20 zum Mast hin versetzt.
National- und Handelsflagge des Deutschen Reiches von 1935 bis 1945, zugleich Gösch der Kriegsschiffe.
Das Hakenkreuz ist im Vergleich zur Parteiflagge der NSDAP um 1/20 zum Mast hin versetzt.
Flag of Italy from 1946 to 2003, when exact colors were specified.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

Trikot Deutscher Meister