Antoniter-Orden
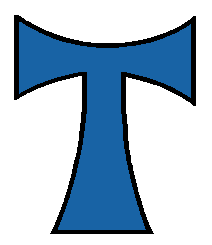
Der Antoniter-Orden (Canonici Regulares Sancti Antonii, Ordenskürzel CRSAnt; auch Antoniusorden, Antonier, Antoniterorden oder Antonianer) war ein christlicher Hospitalorden. Ursprünglich unter der Bezeichnung Hospitaliter oder Hospitaliten vom Hl. Antonius gegründet, änderte sich diese im Laufe der Zeit in Antonierherren, Antoniusbrüder, Chorherren vom Hl. Antonius; ndt. Tönniesherren; franz. Hospitaliers de St. Antoine, Antonins; engl. Hospitalbrothers. Die Gründung des Ordens erfolgte im 11. Jh. in Frankreich. Die Antoniter waren der größte und mächtigste Hospitalorden des Mittelalters.[1]
Geschichte
Hochmittelalter

Die Quellenlage zur Geschichte des Ordens ist für das Mittelalter schwierig, da ein Brand im Hauptarchiv des Ordens im Jahr 1422 in St.-Didier-la-Mothe (auch St-Didier-de-la-Motte oder La-Motte-Saint-Didier; heute: Saint-Antoine-l’Abbaye) in der Dauphiné in Südostfrankreich sowie die Verwüstungen der Hugenottenkriege im Jahr 1567 viele Dokumente zerstörten. Die Geschichtsschreibung stützt sich überwiegend auf lokale Monographien, und ein genaues Gründungsjahr kann nicht bestimmt werden.

Für die Entstehung des Ordens lassen sich zwei wesentliche Gründe nennen: Erstens brachte der französische Ritter Jocelin von Châteuneuf um das Jahr 1070 eine Reliquie des heiligen Antonius aus Konstantinopel nach Frankreich und übergab sie der Kirche von St.-Didier-de-la-Motte. Zweitens gründete der französische Adlige Gaston an diesem Ort eine Gemeinschaft, um seiner Dankbarkeit für die Heilung seines Sohnes Guerin vom Antoniusfeuer durch die wundertätige Reliquie des heiligen Antonius Ausdruck zu verleihen. Zunächst schlossen sich Männer und Frauen unterschiedlichen Standes aus der Umgebung zu einer Laiengemeinschaft zusammen, die Bedürftigen helfen wollte. Der starke Zustrom Hilfesuchender machte bald den Bau eines eigenen Hauses notwendig, das als domus elemosinaria (Haus des Almosens) bekannt wurde. In der Folge entwickelte sich der Ort rasch zu einer Pilgerstätte. Im Jahr 1175 wählten die Ordensbrüder und -schwestern als gemeinsames Erkennungszeichen das blaue Tau.[2][3]
Um das Jahr 1095 könnte die Gemeinschaft als Laienbruderschaft gegründet worden sein. Dass diese von Papst Urban II. als Orden bestätigt worden sein soll, wird in den Darstellungen zur Historie des Ordens widersprüchlich dargestellt. Der Ordenschronist Aymar Falco erwähnt diesen Aspekt in seiner Abhandlung nicht, während der Historiker Henri Tribout de Morembert dies für möglich hält. Wenig später soll das erste Spital, das als Hospiz Domus elemosinaria bekannt wurde, erbaut worden sein. Das Stammkloster der Bruderschaft und des späteren Ordens wurde die Abtei Saint-Antoine-l’Abbaye. Die 1119 erfolgte Weihe der ersten Antoniuskirche durch Papst Calixt II. wird als möglich erachtet, gilt jedoch als nicht gesichert, da die dazugehörige päpstliche Bulle heute als Fälschung angesehen wird.[4][5]
Aufgrund seiner Erfolge bei der Behandlung der Erkrankung Antoniusfeuer expandierte der Orden ab dem 12. Jahrhundert u. a. nach Spanien, Flandern, Italien, England und Deutschland. Herzog Welf VI. von Bayern hinterließ den Antonitern seine Burg in Memmingen, und ab 1192 gründeten diese dort ihr Kloster. Im Jahr 1215 verlieh Kaiser Friedrich II. den Antonitern das Patronat der dortigen Kirche.[6] Es folgten Klostergründungen in Grünberg in Hessen (vermutlich 1193) und Tempzin in Mecklenburg (1222). Von Tempzin aus breitete sich der Orden in den folgenden Jahrzehnten weiter in den Ostseeraum aus, mit Niederlassungen in Mohrkirch (Schleswig-Holstein), Præstø (Dänemark), Ramundeboda (Schweden), Nonnesetter bei Bergen (Norwegen), Frauenburg im Ermland und Lennewarden in Livland. Weitere Niederlassungen entstanden u. a. in Akkon (Israel), Bkerke (Libanon) und Famagusta (Zypern).
Die rasante Entwicklung und Verbreitung des Ordens wäre ohne die gleichzeitige Verbreitung des Antoniuskultes nicht denkbar gewesen. Der Orden stützte sich dabei auf die religiösen Vorstellungen der Menschen im Mittelalter und nutzte diese geschickt für seine Zwecke. Die Ursache der Antoniusfeuer-Erkrankung wurde damals in einem „sündigen“ Lebenswandel gesehen. Die Lebensführung und die Standhaftigkeit des hl. Antonius gegenüber allen Versuchungen galten den Menschen als vorbildhaft für ein gesundes und gerechtes Leben.[7] Zur Bekanntheit und Verbreitung des Ordens trugen auch die Pilger auf ihrem Weg nach Santiago de Compostela bei. Es war damals üblich, dass ursprünglich rein lokale oder regionale Heilige, wie etwa der heilige Antonius, durch die Rückkehr der Pilger in ihre Heimatgebiete eine weitere Verbreitung fanden.
Durch ein Dekret von Papst Honorius III. war die Bruderschaft ab 1218 dazu verpflichtet, gemäß den Statuten der regulierten Augustiner zu leben und die drei Ordensgelübde abzulegen.[8]
Im Jahr 1232 wurden die ersten Ordensstatuten, bestehend aus 17 Punkten, verfasst. Sie umfassten die drei üblichen, von den Benediktinern beeinflussten Ordensgelübde und galten sowohl für die Brüder als auch die Schwestern des Ordens. Im Jahr 1234 gestattete Papst Gregor IX. dem Orden, einen eigenen Friedhof anzulegen und die Sakramente an alle Bewohner des Hospitals zu spenden. Ab 1247 lebten die Brüder nach den Ordensregeln des hl. Augustinus. Frauen wurden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als vollwertige Ordensmitglieder zugelassen.
In St.-Didier-la-Mothe entbrannte in dieser Zeit ein jahrzehntelang andauernder offener Konflikt zwischen den ortsansässigen Benediktinern, die das Priorat über die Reliquie und die Kirchen innehatten, und den Antonitern, die nach Unabhängigkeit strebten und für die Hospize sowie die Versorgung der Pilger verantwortlich waren. Der Konflikt beruhte u. a. auf Interessengegensätzen hinsichtlich der Verteilung der wachsenden Einnahmen aus den Wallfahrten.
Spätmittelalter
1265 wurde dem Orden unter Papst Clemens IV. das Recht verliehen zum Unterhalt seiner Hospitäler Almosen zu sammeln. Saint-Antoine wurde 1293 zur Abtei erhoben. Der teilweise blutig geführte Konflikt mit den Benediktinern endete mit der päpstlichen Bulle von 1297 unter Papst Bonifatius VIII. Die Benediktiner mussten den Ort verlassen. Die Antoniter mit ihren Hospizen, den Kirchen und die Reliquie wurden unter direkte päpstlicher Aufsicht gestellt. Im gleichen Jahr wurde die Bruderschaft durch Bonifatius VIII. in einen Chorherrenorden umgewandelt und formell als selbständiger Orden (Regularkanoniker) anerkannt. Bei den Antonitern handelte es sich somit um eine besondere Gruppe regulierter Augustinerchorherren. An der Spitze stand der Abt von Saint-Antoine. 1298 wurde eine neue Satzung des Ordens angenommen. Seither werden die Antoniter zu den Hospitalorden gezählt. Der neue Orden war ab dieser Zeit auch für die Krankenfürsorge am päpstlichen Hof verantwortlich.

Die folgenden zwei Jahrhunderte waren in der Entwicklung des Ordens von Phasen der Blüte und von Krisen geprägt. Der Orden monopolisierte und standardisierte den Antoniuskult und konnte sich dabei auf päpstliche Unterstützung stützen. Urban IV. verfügte, dass alle Gelübde beim Hospital in Saint-Antoine und den Niederlassungen einzulösen sein. Johannes XXII. verbot die Errichtung von ordensfremden Antoniusaltären und -kapellen. Hospitalinsassen war es verboten zu betteln. Als Strafe drohte lebenslanger Kerker.[9] Im Jahr 1345 beschloss das Generalkapitel des Gesamtordens, dass der Abt und alle Brüder Liegenschaften erwerben und behalten durften, um diese für Messen, Jahrestage und andere geistliche Zwecke zu nutzen. Parallel dazu bestand das Bestreben, ständig neue Klosterpfründe zu schaffen, darunter auch solche, die nicht mit einem Klosteramt, wie etwa dem eines einfachen Chorherren, verbunden waren. Ordensbrüder durften u. a. Geldgeschäfte tätigen, Bannrechte ausüben und Honorare für die Beratung weltlicher Herrscher annehmen. Im weiteren Verlauf führte dies zu einer zunehmenden Verweltlichung des Ordens.
Zahlreiche Fehden, Miss- und Vetternwirtschaft stürzten im ausgehenden 14. Jahrhundert das Mutterkloster in Schulden. Zu ihrer Deckung wurden regelmäßig die anderen Präzeptoreien herangezogen. Äbte und andere Amtsträger des Ordens scheuten sich nicht, über die römische Kurie Ämter und Einkünfte für die eigenen Angehörigen zu erbitten. Adlige, Würdenträger und deren Freunde versuchten ihrerseits, sich Pfründe durch die Bekleidung eines Amtes im Orden zu verschaffen. Dies höhlte die Ordensverfassung aus und führte zu zahlreichen kostenträchtigen Prozessen. Aufgrund der zentralistischen Ordensstruktur kam es immer wieder zu Spannungen zwischen dem Stammkloster und den nach Unabhängigkeit strebenden großen Präzeptoreien. Beispielsweise ließen sich die einzelnen Präzeptoreien durch die römische Kurie gerne lokale Privilegien (wie z. B. privilegium creandi religiosos für das Kloster Tempzin) verbriefen. Die Verwerfungen wurden durch die Ordensreform von 1367 nicht behoben. Der Orden konnte seine internen Schwierigkeiten nicht auflösen.

Die Antoniter standen während des Abendländischen Schismas dem avignonesischen Papsttum besonders nahe. Dies lag zum einen an der geringen Entfernung von 180 Kilometern zwischen Avignon und ihrem Hauptsitz. Zum anderen bestanden auch soziale Beziehungen zur römischen Kurie, da dieselben regionalen Territorialherren und Adelsgruppen an beiden Orten Einfluss ausübten.[10] Zu Beginn des Schismas löste sich die Generalpräzeptorei in England vom Mutterkloster in St-Antoine. Der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England beschleunigte diese Entwicklung. Die Präzeptorei stellte ab 1377 die Zahlungen an das Mutterkloster ein. Im Jahr 1414 wurde das Kloster durch den Alien Priories Act, unterzeichnet von König Heinrich V., der englischen Krone unterstellt.[11] Papst Nikolaus V. bestätigte die Unabhängigkeit der Präzeptorei, und spätere Versuche der Wiederherstellung der früheren Ordnung scheiterten. Das Schisma führte dazu, dass die Präzeptoren den jährlichen Generalkapiteln zunehmend fernblieben. Gleichzeitig zeigten sie weniger Interesse an Belangen wie den Ordensreformen des Gesamtordens. Die Präzeptoreien erlangten in der Folgezeit eine größere Unabhängigkeit vom Mutterkloster. Papst Martin V. förderte diese Entwicklung dadurch, dass er 1418 das frühere Consuetudo aufhob. Eine weitere Folge des Schismas war ein Nachlassen des Gehorsams gegenüber dem Abt und dem Mutterkloster. Dazu kamen ein Schwinden des Zusammengehörigkeitsgefühls und der inneren Bindung, das rücksichtslose Durchsetzen persönlicher Interessen sowie die Aufnahme Ordensfremder in Ämter. Fiskalische Gesichtspunkte überwogen, es kam zur Veräußerung von Ordensvermögen und zu Verschuldungen. Schließlich führte dies zu einem Verlust an Ansehen in den Augen der Gläubigen.

Aufgrund äußerer und innerer Missstände entwickelte sich der Orden in der Folgezeit zu einem reinen Bettelorden. Der Orden führte das Terminiersystem ein, das ihm und den betreuten Kranken eine finanzielle Absicherung bieten sollte.[12] Für den Unterhalt der Klöster durften die Klosterbrüder nun Almosen sammeln und in den Gassen der Städte und auf dem Land Antoniusschweine frei laufen lassen.
Nach dem Ende des Abendländischen Schismas erschwerte das in Spanien und Italien aufkommende Staatskirchenrecht die Einheit des Ordens. Im Jahr 1418 kam es durch die Annullierung der Wahl von Jean de Montchenu durch Papst Martin V. zu einem dreijährigen Ordensschisma. 1419 sollten unter Androhung der Exkommunikation alle Präzeptoren zu einem Generalkapitel in Florenz zusammenkommen. Dieser Versuch scheiterte, und das Kapitel fand schließlich 1420 in Mailand statt. Dort waren die versammelten Antoniter gezwungen, dem päpstlichen Favoriten Artaud de Grandeval zu huldigen und ihn als einzigen und rechtmäßigen Abt von St-Antoine anzuerkennen. Die Ordensstatuten wurden neu gefasst und verabschiedet. Hauptziel der Reformen war es, den schwindenden Zusammenhalt des Ordens wieder zu stärken. In der Folgezeit entfalteten die Reformen jedoch nur eingeschränkt die vom Papst erhofften Wirkungen.[13]
Durch die Gründung von Antonius-Confraternitäten oder Antoniusgilden erfuhr der Orden eine Belebung. Die Gilden verfolgten den Zweck, den herumziehenden Antonitern Obdach zu gewähren und Gelder für die Präzeptoreien und das Stammkloster zu sammeln. Andererseits verfolgten sie auch karitative Zwecke, indem sie an bestimmten Tagen Almosen an Bedürftige verteilten. Die Antoniusgilden wurden wesentlich durch angesehene Patrizier aus der Umgebung der jeweiligen Klöster geprägt. Im 15. Jahrhundert besaß der Orden mehr als 200 Komtureien und mehr als 370 Krankenhäuser in ganz Europa und im Heiligen Land.[14]
Die Antoniter erhielten Konkurrenz, als Sixtus IV. auch dem Heilig-Geist-Orden erlaubte, Schweine auf Kosten der Allgemeinheit zu halten und daraus Einnahmen zu erzielen. Im weiteren Verlauf des Spätmittelalters führte das steigende Hygienebewusstsein in den Städten dazu, dass die Haltung von Schweinen zunehmend problematisch wurde. Städte wie Lübeck, Bamberg, München oder Würzburg beschränkten die Anzahl der Schweine für die Antoniter. Einige italienische Städte verboten die Tiere ganz. Die lukrativen Einnahmen nahmen ab oder entfielen vollständig.
Um dem inneren und äußeren Verfall des Ordens entgegenzuwirken, wurde 1478 eine umfassende Ordensreform eingeleitet. Im Frühjahr desselben Jahres entstanden 13 neue Statuten. Doch für die Neuordnung und Wiederherstellung des Antoniterordens blieb angesichts der bevorstehenden Reformation nur wenig Zeit.
Die Berichte darüber, dass die Reliquie des hl. Antonius im Jahr 1491 in die Kirche St. Julien nach Arles gebracht wurde, sind widersprüchlich. Adalbert Mischlewski betrachtete dies als widerlegt.[15]
Neuzeit

1502 verlieh Kaiser Maximilian den Antonitern ein Wappen als Zeichen seiner Anerkennung und Unterstützung. Der Reichsadler mit goldener Krone symbolisierte die königliche Protektion sowie den hohen gesellschaftlichen Status des Ordens.[16] Im Jahr 1514 gründeten die Brüder von Tempzin in Lennewarden (Livland) die letzte Präzeptorei ihres Ordens.
Der Niedergang des Antoniterordens zog sich über mehr als zwei Jahrhunderte hin. Infolge der Reformation und der Hugenottenkriege in Frankreich ging die Bedeutung des Ordens stark zurück. Die personelle Besetzung der einzelnen Niederlassungen war häufig zu gering, um ein geordnetes Klosterleben und eine funktionierende Hospitaltätigkeit sicherzustellen. Zudem waren die Präzeptoreien durch innere Zerwürfnisse, Misswirtschaft und die Vernachlässigung der klösterlichen Pflichten in ihrem Bestand gefährdet.[17]
1534 veröffentlichte der Antoniter Aymar Falco in Lyon die erste Abhandlung über die Historie des Ordens. Als das Konzil von Trient 1546 und 1562 Almosenfahrten allgemein verboten hatte, konnte der Antoniterorden eine Ausnahme für diese erwirken.
Im Jahr 1597 entdeckte die Medizinische Fakultät der Universität Marburg den Zusammenhang zwischen von Mutterkornpilz befallenem Getreide und der Erkrankung an Antoniusfeuer. Im Jahr 1630 hatte Tuillier der Ältere, Leibarzt des Herzogs von Sully in Angers, das Mutterkorn als Ursache für jene Form der Gangrän erkannt, die in der Sologne – einem sumpfigen Gebiet südlich von Orléans – endemisch war.[18] Mit der Entdeckung der Ursache und des Zusammenhangs der zur Erkrankung führte und durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, verlor der Orden seine Patienten und damit seine Aufgabe. Das Alleinstellungsmerkmal zur Behandlung von Erkrankten wurde bedeutungslos.
1616 wurde mit der Verabschiedung neuer Reformstatuten versucht, den Orden zu reformieren. Das Amt des Präzeptors wurde abgeschafft. An der Spitze der Klöster stand nun ein Superior mit einer dreijährigen Amtszeit. Diese Statuten wurden von den Klöstern außerhalb von Frankreich nicht angenommen worden.
Der Prozess des Niedergangs verlief in den verschiedenen Ländern auf unterschiedliche Weise. In Ungarn zogen sich einige Mönche nach der Auflösung der Antoniterklöster in die Nähe des Wallfahrtsortes von Mátraverebély zurück und lebten dort in Einsiedlerhöhlen. Ihre Anwesenheit lässt sich bis ins 18. Jahrhundert nachweisen.[19]
In der Schweiz wurden sämtliche Klöster während der Reformationszeit säkularisiert und in Deutschland bis Mitte des 16. Jahrhunderts fast alle Niederlassungen des Ordens aufgehoben. Die Klöster gingen in den Besitz der Landesherren über. Ab 1777 wurden die letzten 33 in Deutschland verbliebenen Häuser inkorporiert. Das Kloster in Köln mit seinem 300 Morgen großen Gutshof in Kriel sowie das Kloster in Höchst entzogen sich zunächst dem päpstlichen Dekret. Beide wurden 1803 säkularisiert.[20][21][22][23]

In Spanien überstanden die Antoniterklöster die Reformationszeit und erlebten ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine kleine Renaissance. Sie trennten sich vom Gesamtorden und gaben sich 1731 neue Statuten. Die Mönche trugen auf ihrem Habit ein rotes Tau-Kreuz. In den Hospitälern war es gängige Praxis, amputierte Gliedmaßen an den Toren aufzuhängen. Das Sammeln von Almosen und Naturalien war ebenso üblich wie das Halten von Schweinen auf Kosten der Allgemeinheit. Im Jahr 1562 errichteten Antoniter aus dem Kloster Castrojeriz in Mexiko-Stadt ein neues Kloster und eröffneten ein dazugehöriges Spital. 1787 löste König Carlos III. mit Unterstützung einer päpstlichen Bulle den Orden auf. Carlos IV. erlaubte den Alt-Antonitern zur Sicherung ihrer Existenz weiterhin das Halten von Antoniusschweinen. Diese Praxis hielt sich in einigen Gegenden bis ins 20. Jahrhundert. Diese wurden am Antoniustag für die Allgemeinheit verlost.[24][25] Im Jahr 1791 wurden die meisten Klöster aufgelöst, während die Spitäler in die Verwaltung der örtlichen Städte und Gemeinden übergingen.
Im Jahr 1768 untersagte ein königliches Dekret von Ludwig XV. den französischen Klöstern, Novizen und Ausländer in ihre Reihen aufzunehmen, was den Orden mit seinen verbliebenen Niederlassungen besonders hart traf. Papst Pius VI. verfügte am 17. Dezember 1776 die Aufnahme der Antoniter in den Malteserorden. Bereits 1774 hatte das Generalkapitel der Antoniter der Inkorporation zugestimmt. Im Revolutionsjahr 1789 gab es noch 66 Antoniter in Frankreich. Drei von ihnen leisteten den Eid auf die Zivilverfassung des Klerus. Die übrigen Brüder wurden entweder verbannt oder inhaftiert. Einige von ihnen starben in den Gefängnissen, andere wurden erschossen oder guillotiniert.
Der Verbleib der Reliquie des hl. Antonius ist schwer nachzuvollziehen. Während der Reformation und der Hugenottenkriege wurden viele Reliquien und deren kostbare Schreine zerstreut oder zerstört, so auch der Antoniusschrein in St.-Antoine. Partikel der Reliquie sollen sich unter anderem in Echternach, Köln (Arm- und Bartreliquie) und Florenz befinden. Im Jahr 2017 wurde in Anwesenheit des Bischofs von Grenoble, Guy de Kerimel, dem im Jahr 1648 neu gestifteten Reliquienschrein in St.-Antoine ein Fußknochen entnommen, um den Neubau der Residenz des rumänisch-orthodoxen Patriarchen in Bukarest zu fördern.[26] Die Mönche des Antoniusklosters in Ägypten sind hingegen fest davon überzeugt, dass die sterblichen Überreste ihres Heiligen nach wie vor an ihrem ursprünglichen Bestattungsort ruhen.
Aufgaben und Organisation des Ordens

Aufgaben
Die Aufgabe des Ordens war in erster Linie die Pflege und Behandlung am Antoniusfeuer (auch Kriebelkrankheit) Erkrankter, einer im Mittelalter in Europa weit verbreiteten Krankheit, die durch den Genuss von mutterkornverseuchtem Brot verursacht wurde. Dafür richteten sie spezialisierte Hospize ein. Die Erkrankten erhielten eine dem Ordenskleid ähnliche Tracht, mit der sie quasi den Status von Ordensleuten annahmen. Im Weiteren gehörte die Fürsorge von Armen, die Versorgung von Pilgern, Obdachlosen und Waisen zu ihren Aufgaben.
Organisation
Ämter
Der Abt von Saint-Antoine stand seit 1297 an der Spitze des Ordens. Ihm oblag die oberste Gewalt über alle Generalpräzeptoreien und Präzeptoreien. Nach dem Abt folgte im Mutterkloster das Amt des Priors, dem die Hausleitung oblag. Ihm unterstellt war der Cellerar, dem die Verwaltung für die Verteilung der Lebensmittel an die Klosterangehörigen und Armen sowie der Almosen oblag. Der Abt berief die Generalpräzeptoren, den Prior und den Cellerar. Der Abt wurde durch vier Berater (Diffinitoren) unterstützt. Er war verpflichtet, ihre Meinungen vor der Gründung neuer Präzeptoreien, der Veräußerungen von Gütern, bei größeren Erwerbungen oder andere wichtige Angelegenheiten einzuholen. Zur Aufnahme neuer Brüder in den auswärtigen Präzeptoreien bedurfte es der Zustimmung des Abtes.
Ab 1477 übertrugen die reformierten Ordensstatuten die ganze Macht über die einzelnen Präzeptoreien den Präzeptoren. Gleichzeitig kamen sie in den Genuss der Pfründe der Präzeptoreien.
Wahl des Abtes
Der Abt wird nach der Wahl durch den Konvent des Mutterklosters vom Papst ernannt. Seine Amtszeit war auf Lebenszeit.
Aufgaben und Pflichten
Die Zuständigkeiten für die Aufgaben und Pflichten innerhalb des Ordens waren klar geregelt. Die Ordens-Priester betreuten die Pilger und waren zuständig für den Chordienst sowie für die geistliche Begleitung der Kranken. Die Laienbruder waren für die Krankenfürsorge verantwortlich und die Konversen verrichteten alle anderen einfachen Arbeiten im Kloster.
Kapitel
Jährlich wurde ein Generalkapitel am 17. Januar, dem Gedenktag des hl. Antonius, einberufen. Aufgrund der beschwerlichen winterlichen Anreise wurde das Generalkapitel später dann an Himmelfahrt zusammengerufen. Alle Präzeptoren, die weniger als 10 Tagereisen von der Abtei entfernt wohnten, waren verpflichtet, in Saint-Antoine zu erscheinen. Die weiter entfernt wohnenden Präzeptoren mussten alle 3 Jahre erscheinen. Bei der Zusammenkunft wurden unter anderem Entscheidungen gefällt wie die Ernennung von Präzeptoren, die Aufnahme neuer Brüder oder finanzielle und verwaltungsmäßige Angelegenheiten.
Gliederung
Der Orden war dem Apostolischen Stuhl direkt unterstellt und zentralistisch aufgebaut. Dem Abt unterstanden 43 Generalpräzeptoreien. Denen wiederum unterstellt waren die 370 Präzeptoreien (Klöster) mit ihren Höfen und den angeschlossenen Hospizen in allen Ländern. Die Präzeptoreien wurden nach dem Vorbild der Ritterorden in Balleien untergliedert. Die Balleien waren verpachtete Sammelbezirke, deren jeweiliger Mittelpunkt ein gemietetes Terminierhaus war.
Habit
Seit 1297 tragen alle Mitglieder im Chordienst Kanonikerkleidung (Rochett und Mozetta) und zu Ehren des hl. Antonius das Tau-Zeichen (Potentia - Antoniuskreuz). Die Kleidung war einfach. Sie setzte sich aus eiem schwarzen weiten Talar mit großer Kapuze und einem am Hals mit einer Agraffe geschlossenen Mantel zusammen. Beide Kleidungsstücke waren auf der linken Seite mit dem Ordenszeichen versehen.
Liste der Vorsteher der Gemeinschaft und Großmeister von Saint-Antoine
- 1. Gaston (Lord von Valloire, Gründer des House of Alms) 1095–1120
- 2. Stephan † 1131
- 3. Nanthelm de Soffred † um 1160
- 4. Guillaume le Roux (Gulielmus Rufus) † 1181
- 5. Peter Soffed † um 1202
- 6. Bruno von Sens
- 7. Falko I. (Ordenserweiterung nach Ungarn und Akkon)
- 8. Stephan II. ca. 1233–1242
- 9. Falko Matthionis † 1254
- 10. Wilhelm Soffred (Ordenserweiterung nach England)
- 11. Pontius Rufus (Ponce Le Roux)
- 12. Jocelin de La Tour
- 13. Wilhelm von Parnans
- 14. Wilhelm des Bons
- 15. Wilhelm Daniel Rufus † 1272 oder 1273
- 16. Stephan III. (Trat schnell nach seiner Wahl zurück.)
- 17. Aymon de Montaggny 1273-1316 (Gouverneur der Dauphiné, erreichte 1297 die Autonomie des Ordens und wurde erster Abt.)[27]
Liste der Äbte
- 2. Ponce de Layrac (1316-1328)
- 3. Wilhelm Mitte (1328–1342) (Sohn von Bertrand Mitte, Marschall der Dauphiné)
- 4. Pierre Loubet (1342–1369) (Er unterzeichnet die Abtretungsurkunde der Dauphiné an Frankreich)
- 5. Ponce Mitte (1369–1374) (Neffe von Guillaume Mitte, baute das große Refektorium in Saint-Antoine)
- 6. Bertrand Mitte (1374–1389) (Neffe von Ponce Mitte)
- 7. Gérenton de Châteauneuf (1389–1407)
- 8. Hugues de Châteauneuf (1407–1418) (Stammt aus der gleichen Familie wie Gérenton de Châteauneuf.)
- 9. Falque de Montchenu (1418-1418) (Die Wahl des jüngeren Bruders Jean de Montchenu zum Nachfolger wurde von Papst Martin V. annulliert und führte zum Ordensschisma.)
- 10. Arthaud de Grandval (1418–1427)
- 11. Jean de Polley (1427–1438)
- 12. Humbert de Brion (1438–1459)
- 13. Antoine de Brion (Vom Orden gewählt und von Papst Pius II. abgesetzt.) und Benoit de Montferrand (1460-1470) (Vom Papst ernannt.)
- 14. Jean Joguet (1470–1482) (Von Papst Sixtus IV. ernannt. Er reformierte die Verfassung des Ordens.)
- 15. Antoine de Brion (1482–1490) (Er wurde 1459 zum Abt von Saint-Antoine gewählt und durch Papst Julius II. ersetzt worden. Beginn des Streits mit der Abtei Montmajour über die Reliquien des Heiligen Antonius.)

- 16. Antoine de Roquemaure (1490–1493)
- 17. Pierre de l´Aire (1493–1495)
- 18. Theodor de Saint-Chamond (1495–1526) (Er beendete den Streit um die Reliquien des Heiligen Antonius.)
- 19. Antonie de Langeac (1526–1537) (Innerer Streit, verließ die Abtei nach 2 Jahren.)
- 20. Jaques de Joyeuse (1537–1542) (Blieb Domdekan von Puy und war selten in der Abtei anwesend.)
- 21. Francois von Tournon (1542–1562) und François de Langeac (1551-1562), Co-Abt mit François de Tournon
- 22. Louis de Langeac (1562–1597)
- 23. Antoine Tolosain (1597–1615)
- 24. François de Marchier, Antoine Brunel de Gramont (1615–1635) (Versucht die Bestätigung einer mit Nichtigkeit behafteten Wahl zu erhalten.)
- 25. Jean Chastain (1636–1645)
- 26. Jean Rasse (1645–1673)
- 27. Claude Sup (1676–1678) (Intrigen verhindern die regulären Wahlen für 28 Monate.)
- 28. Antoine Payn La Jasse (1678–1687)
- 29. Georg Paul de Maulevrier Langeron (1688–1700) (Er muss nach einem Urteil des Bischofs von Grenoble zurücktreten.)
- 30. Jean Danthon (1702–1732)
- 31. Nikolaus Gasparini (1732–1747)
- 32. Stephan Galland (1747–1769)
- 33. Jean-Marie Navarre (1769–1775) (Letzter Abt, Verhaftung und ins Gefängnis nach Grenoble gebracht.)
Questplanung
Es entwickelte sich der Brauch, umherziehende Antonitermönche, sogenannte Almosenbitter (Antoniusbote), in die Dörfer und Städte zu senden. Diese führten auch Reliquien des hl. Antonius mit sich. Die Sammelfahrten, Quest genannt, erreichten jährlich nahezu alle Pfarreien Europas und bildeten mit zwei Dritteln der Gesamteinnahmen die wichtigste Finanzquelle des Ordens. Im Spätmittelalter waren diese Almosenfahrten straff organisiert und zentral gelenkt. Zur weiteren Optimierung wurden Laienschwestern und -brüder angeworben, die sich zu festgelegten Abgaben verpflichteten und dem Orden so berechenbare Einnahmen garantierten.[28] Die Namen der Laien und die Höhe ihrer Abgaben wurden in sogenannten Terminierbüchern verzeichnet, in einer gesonderten Rubrik auch die verstorbener Laien. Der Antoniusbote plante seine Quest auf Grundlage dieser Bücher.[29] Diese Terminierbücher dienten als eine Art „Reiseführer“, Gedächtnisstütze und Ratgeber für nachfolgende Antoniusboten. Sie enthielten unter anderem Ortsnamen, Hinweise zu Geschenken für Ortspfarrer sowie Reiserouten. Darüber hinaus wurde ein zentralisiertes Registrierungssystem eingeführt, das den jährlichen Austausch von materiellen und ideellen Gütern dokumentierte. Personen, die einmal in diesen Terminbüchern verzeichnet waren, wurden ein Leben lang nach Allerheiligen von den Antoniusboten besucht.[30] In Not- oder Dürrejahren wurde die Sammelerlaubnis nur selten von einigen Bischöfen verweigert.
Der Antoniusbote wurde in den Gemeinden mit einer Predigt empfangen und sammelte anschließend Gaben von der Dorf- und Stadtbevölkerung ein, die aus Münzen oder haltbaren Lebensmitteln bestanden. Um das Problem der Haltbarkeit von Lebensmitteln zu umgehen, nahm der Orden auch lebende Ferkel als Spenden an. Es war üblich, dass Menschen, die kein Geld spenden konnten und wenig besaßen, ein Ferkel stifteten. Diese Ferkel wurden mit einem Glöckchen am Hals oder am Ohr als Eigentum des Ordens gekennzeichnet. Der Orden hatte das Recht, seine Schweine frei in den Gassen der Städte oder im Gemeindewald der Dörfer laufen zu lassen und von der Allgemeinheit „durchfüttern“ zu lassen.
Am Antoniustag, dem 17. Januar, wurden einige dieser Schweine geschlachtet, und das Fleisch wurde an Arme oder Erkrankte in den Hospizen verteilt, um das Vorbild des hl. Antonius zu ehren. Der Großteil der Schweine wurde jedoch verkauft, und der Erlös verblieb zunehmend in den umliegenden Präzeptoreien des Sammelbezirkes, da die Klöster immer unabhängiger wurden. Das Verhältnis von Geben und Nehmen war unausgewogen, beruhte jedoch auf Freiwilligkeit. Die hohen Einnahmen standen oft im Gegensatz zu den Ausgaben für die wenigen Erkrankten, die versorgt werden mussten. In den Hospizen wurden selten mehr als zehn Erkrankte aufgenommen, deren Anwesenheit zunehmend symbolischen Charakter hatte.[31][32]
Sebald Beham (1500–1550), ein Nürnberger Maler und Grafiker, drückte in einem illustrierten Vers die Skepsis seiner Zeitgenossen gegenüber den aufdringlichen Sammlungen der Antoniter aus:
Anthoni herrn man dise nendt / in alle landt man sie wol kendt / das macht ir stettes terminiren / das arm volck sie schentlich verfüren / mit trauung sanct Anthoni peyn / bettlen sehr / auch lerns ire schweyn / schwarz / darauff blaw creutz ist ir kleyt / sind all buben schwer ich eyn eyd.
Attribute
- Antoniterkreuz im Antoniterkloster Höchst 2006
- Antoniterkreuze in gotischer Fensterrose des Kloster San Anton de Castrojeriz 2011
- Antoniterschwein, Kölner Dom, Nordportal 2014
- Jan van Eyck, Porträt eines Mannes mit Nelke etwa 1436
Das Ordenszeichen der Antoniter war ein blaues Antoniuskreuz, an dem ein Glöckchen herabhing. Das Tau symbolisierte möglicherweise eine stilisierte Krücke. In der mittelalterlichen Deutung stand es für die Erwählung durch Gott und seinen Schutz.
Heute ist vor allem das sogenannte Antoniterschwein bekannt. Die Antoniter erhielten von der Bevölkerung Ferkel als Spenden, denen sie eine Glocke umhängten, um sie von den Schweinen der Metzger, Bäcker und Müller zu unterscheiden. Zudem wurde das Tau als Erkennungszeichen auf die Haut der Ferkel eingebrannt.[33] Diese Schweine wurden in die Bettelgebiete des Ordens gebracht und dort von der Bevölkerung über das Jahr hinweg gefüttert. Im Herbst holten die Antoniter die inzwischen schlachtreifen Schweine ab, um sie für das Kloster zu schlachten.
Ein weiteres „Markenzeichen“ der Antoniter war die Antoniusglocke. Die Antoniusbote kündigten bei ihren Almosenfahrten durch die Sammelgebiete (Balleien) ihr Kommen mit diesen Glocken an. Darüber hinaus ertönte die Glocke, wenn ein Patient isoliert untergebracht werden musste. Der Pfleger gab mit dem Glöckchen ein Signal, damit sich die Menschen wegen der hohen Ansteckungsgefahr von dem Erkrankten fernhielten.
Behandlungs- und Pflegekonzept

Die Hospitäler der Antoniter stellten eine frühe Form spezialisierter Krankenhäuser dar. In jedem Hospiz wurde ein „Vorzeigekranker“ untergebracht. Nach der Aufnahme der an Mutterkorn Erkrankten erfolgte eine kostenlose öffentliche Untersuchung durch einen eigenen Wundarzt, die mit einer Diagnose abgeschlossen wurde. Wurden die Kranken aufgenommen, unterwarfen sie sich den strengen Ordensregeln, die Gehorsam, ewige Keuschheit und die Verpflichtung zum Gebet (zwölf Vaterunser und zwölf Ave Maria pro Tag) umfassten. Die Behandlung folgte dem Prinzip: Glaube durch Heilung und Heilung durch Glaube.
Nach der Untersuchung wurden die Erkrankten anhand von Pflegekriterien eingeteilt. Die anschließende Therapie bestand aus einem medizinischen Teil, der Kräutertränke und Salben umfasste. Diese konnten sich je nach Region und Kloster unterscheiden. Häufig wurden die Behandlungen von religiösen Ritualen begleitet, wie der Anrufung des hl. Antonius vor einem Altar, einem Bildnis oder einer Statue des Heiligen, sowie der Verwendung von Saint-Vinage (auch Antoniuswein). Dabei handelte es sich um einen Heiltrank auf Weinbasis mit 14 Kräutern, der zu Christi Himmelfahrt in Reliquien des heiligen Antonius getaucht wurde. Dieser Trank hatte harntreibende, entgiftende, gefäßerweiternde und schmerzlindernde Eigenschaften. Ergänzend dazu stellten die Mönche einen entzündungshemmenden Kräuterbalsam (Antoniusbalsam) her und verabreichten ihn.
Alle diese Maßnahmen wurden durch eine gute Hygiene in den Hospitälern und eine hohe Qualität der ausgereichten Lebensmittel, insbesondere des aus Weizenmehl hergestellten Brots, ergänzt.
Die Hospitäler der Antoniter waren eine frühe Form spezialisierter Krankenhäuser. In jedem Hospiz wurde ein „Vorzeigekranker“ untergebracht. Nach dem Empfang der an Mutterkorn Erkrankten folgte eine kostenlose öffentliche Untersuchung durch einen eigenen Wundarzt mit einer anschließenden Diagnose. Wurden die Kranken aufgenommen, mussten sie sich den strengen Ordensregeln unterwerfen wie Gehorsamkeit, ewige Keuschheit und Verpflichtung zum Gebet (zwölf Vaterunser und zwölf Ave Maria pro Tag). Behandelt wurde nach dem Prinzip: Glaube durch Heilung und Heilung durch Glaube. Nach der Untersuchung wurden die Erkrankten nach Pflegekriterien sortiert. Die anschließende Therapie umfasste einen medizinischen Teil unter der Verwendung von Kräutertränken und Salben. Diese konnten sich je nach Region und Kloster unterscheiden. Die Behandlungen gingen häufig mit einem religiösen Ritual wie z. B. der Anrufung des hl. Antonius vor dem Altar, einem Bildnis oder einer Statue des Heiligen sowie der Verwendung von Saint-Vinage (auch Antoniuswein) einher. Dabei handelt es sich um einen Heiltrank auf der Basis von Wein und 14 Kräutern, in den die Reliquien des hl. Antonius zu Christi Himmelfahrt getaucht wurden. Der Trank hatte harntreibende sowie entgiftende, gefäßerweiternde und schmerzstillende Eigenschaften. Im Weiteren wurde ein entzündungshemmender Kräuterbalsam (Antoniusbalsam) von den Mönchen hergestellt und verabreicht. All diese Maßnahmen gingen mit einer guten Hygiene in den Hospitälern und einer hohen Qualität der ausgereichten Lebensmittel und Brot aus Weizenmehl einher.
Ab 1400 wurden in den Hospitälern auch chirurgische Eingriffe bei Ergotismus gangraenosus, der auch als Brandseuche bekannt ist, durchgeführt. Diese Form der Krankheit zeichnete sich durch eine Verengung der Blutgefäße und eine beeinträchtigte Blutzirkulation aus. In extremen Fällen konnte es zu einem vollständigen Stillstand der Durchblutung, toxischen Gewebsnekrosen und dem Verlust von Gliedmaßen kommen. In den meisten Fällen blieb als letzte Möglichkeit nur die Amputation der betroffenen Gliedmaßen, wenn die Behandlung mit Antoniuswein keine nachhaltige Wirkung zeigte.[34]
Der Wundarzt und Feldscher Hans von Gersdorff, der am Antonienhof Straßburg tätig war, erlangte durch sein Geschick großes Ansehen in dieser Zeit. Er warnte vor der unvorsichtigen Verabreichung von „Schlaftränken“ (Narkosemitteln), da solche Betäubungsversuche offenbar oft das gewünschte Maß überschritten. Aufgenommene Patienten konnten ihr Leben lang im Hospital bleiben und wurden dort versorgt. Arbeitsfähige Patienten wurden beispielsweise als Boten für die Hospitäler eingesetzt. Die amputierten Gliedmaßen wurden öffentlich zur Schau gestellt.[35][36][37]
Unter Historikern wird die Frage kontrovers diskutiert, ob nur am Ergotismus Erkrankte Aufnahme in den Spitälern fanden oder auch andere Krankheiten behandelt wurden. Der französische Medizinhistoriker Ernest Wickersheimer berichtet beispielsweise von Verwundeten, die nach der Schlacht bei St. Jakob an der Birs im Jahr 1444 in das Kloster nach Isenheim gebracht wurden. Ihre Kriegsverletzungen hatten sich entzündet und waren brandig geworden. Wickersheimer weist darauf hin, dass auch solche Wunden unter den Begriff Antoniusfeuer fielen. Reiner Marquard verweist darauf, dass je nach Standort, Größe und Funktion des Spitals mitunter auch ein Leprosenhaus, z. B. für die Behandlung von Pesterkrankten, angeschlossen war.[38]
Im Spätmittelalter fasste man unter dem Begriff Antoniusfeuer verschiedene Arten von Gangränen zusammen, wie beispielsweise Wundbrand, Altersbrand oder ulcerösen Syphilid.[39]
Abwesenheit antonitischer Theologie und eremitischer Praxis
Die Antoniter entwickelten keine eigenständige und systematisch ausgearbeitete Theologie wie andere Orden, etwa die Dominikaner oder Franziskaner. Ihr Schwerpunkt lag auf der praktischen Arbeit, insbesondere in der Krankenpflege sowie der karitativen und therapeutischen Fürsorge.
Ein eremitisches oder asketisches Leben spielte bei den Antonitern keine nennenswerte Rolle. Im Gegensatz zu Orden wie den Kartäusern lebten die Antoniter in Gemeinschaften. Historische Quellen zu diesem Thema sind bisher kaum oder nicht bekannt.
Antoniter-Klöster im Heiligen Römischen Reich (HRR) (Auswahl)
- Antoniterkirche (Bern) 2014
Eine der ersten Niederlassungen der Antoniter im HRR war 1214 Memmingen. Hier befindet sich heute auch das Antoniter-Museum, das der Geschichte des Ordens und seiner Wirkungsgeschichte gewidmet ist. Weitere Klöster:
- um 1190 Roßdorf, seit 1441 in Höchst am Main (Justinuskirche, Antoniterkloster Höchst)
- 1193 Grünberg (Hessen), Antoniterkloster Grünberg,
- 1222 Tempzin in Mecklenburg (Tochtergründung von Grünberg) mit dem Haus der Antoniter (Wismar)
- Mitte 13. Jh. Antoniterkloster Issenheim, Isenheim (Elsass)
- um 1280 Bern, Haus Bern
- 1287 Oppenheim, St. Antoni Oppenheim, bereits vor der Reformation aufgegeben
- um 1290 Freiburg im Breisgau
- 1315 Prettin, Haus Lichtenbergk
- 1384 Köln, Antoniterkirche (Köln)
- 14. Jahrhundert Antoniterkapelle (Mainz)
- 1391 Mohrkirch, Schleswig-Holstein (Tochtergründung von Tempzin)
- 1393 Nördlingen, Antoniterkloster Nördlingen
- 1426 Antoniterkloster Bedburg-Hau bei Cleve bis 1535
- 1434 Würzburg, Antoniterkloster Würzburg
- 1444 Regensburg
- 1454 Bamberg, Antoniterkloster Bamberg
- 1456 Nimburg
- 1490 Eicha
- 1492/93 Arolsen, Kloster Aroldessen
Rezeption in der Kunst
Die Versuchungen des heiligen Antonius sowie Darstellungen zum Antoniusfeuer sind seit dem späten Mittelalter zu einem häufigen dargestellten Motiv in der Kunst geworden. Zunächst vor allem in der Malerei und Bildhauerkunst vertreten, fanden sie ab dem 18. Jahrhundert auch in der Literatur, Musik, im Theater und gelegentlich im Film ihren Platz. Unmittelbare Darstellungen oder literarische Werke zu den Antonitern und ihrem Klosterleben sind hingegen eher selten.
Bildende Kunst


Der Orden übte keine nennenswerte stilbildende Kraft in der Architektur aus und schuf keinen eigenen Kirchentyp. Ihre Bauten orientierten sich häufig an den landesüblichen Formen der Kirchen von Bettelorden. Gelegentlich übernahmen sie ältere Kirchenbauten, ohne wesentliche Veränderungen vorzunehmen. In Einzelfällen wurde durch äußeren Skulpturenschmuck auf den Ordensheiligen verwiesen, wie beispielsweise bei der Antoniusstatue am Nordportal in Frankfurt-Höchst, dem Portalrelief mit Antonius und Paulus in der Wüste oder einer Reliefplatte mit dem hl. Antonius und einem Antoniterschwein in Isenheim.
Im Inneren der Antoniterkirchen finden sich häufig Statuen des Heiligen, meist als Sitzfiguren, die oft kolossale Ausmaße aufweisen (zum Beispiel in Tempzin, Höchst und Köln). Unter den dem heiligen Antonius gewidmeten Altären in den Antoniterklöstern befinden sich mitunter bedeutende Kunstwerke, wie der Isenheimer Altar von Nikolaus von Hagenau und Matthias Grünewald, der Antonius-Altar im St.-Annen-Museum in Lübeck oder der Tempziner Hochaltar.
Weitere Arbeiten (Auswahl)
- Martin Schongauer, Die Peinigung des hl. Antonius 1470 und 1475
- Michelangelo, Versuchung des hl. Antonius 1487 oder 1488
- Albrecht Dürer, Der heilige Antonius vor der Stadt 1519 oder Die heiligen Einsiedler Antonius und Paulus um 1504 oder Dresdener Altar um 1496
- Hieronymus Bosch, Versuchung des hl. Antonius (auch Lissaboner Altar) um 1500 und das unter gleichem Namen gestaltete Bild im Museo Nacional del Prado in Madrid vor 1515,
- Giovanni Battista Cima da Conegliano, Drei Heilige: Rochus, Antonius Abt und Lucia ca. 1513,
- Hans Sebald Beham, Der Antoniterorden aus Das Babstum mit seynen glidern 1526
- Pieter Aertsen, Die Rückkehr von einer Wallfahrt zum Heiligen Antonius 1550
- Pieter Bruegel der Ältere, Die Krüppel 1568 oder Die Versuchungen des heiligen Antonius etwa 1550/1575 oder nach 1602
- Jan Brueghel der Ältere Versuchung des hl. Antonius um 1603/1604
- Pieter Brueghel der Jüngere, Die Versuchung des Heiligen Antonius nach 1616
- Jan Brueghel der Jüngere Die Versuchung des Heiligen Antonius um 1620/1630
- Salvador Dalí, Die Versuchung des Heiligen Antonius 1946
- Helmut Maletzke, Darstellung des hl. Antonius 2008
Die Antoniusgilden besaßen, wie andere Bruderschaften, häufig eigene Kapellen und Altäre in den zuständigen Pfarrkirchen oder eine Statue des Heiligen. Der Komtur der Gilde trug zu den Jahresfesten eine Ordenskette, an der häufig ein Antoniusschwein oder ein Relief des heiligen Antonius als besonderes Kennzeichen hing.[40][41][42][43]
Ein weiteres, in Teilen erhalten gebliebenes Zeugnis ist der vor 1505 von Hans Wydyz geschaffene Freiburger Antoniusaltar. Einzelne aus Lindenholz geschnitzte Figuren des Altars, darunter die Antoniusfigur, sind heute Bestandteil des spätbarocken Hochaltars der katholischen Pfarrkirche St. Josef in Obersimonswald oder werden im Augustinermuseum in Freiburg aufbewahrt.
2003 fand auf der Insel Isola Bella (Lago Maggiore) ein internationales Ausstellungsprojekt zum Thema Die Versuchung des Heiligen Antonius statt. Die Rauminstallationen der zeitgenössische Künstler (wie Enrique Asensi, Lore Bert, Harald Fuchs, Peter Gilles, Horst Gläsker, Birgit Kahle oder Ingeborg Lüscher) gaben dem Thema aktuelle Bezüge (u. a. Wiederkehr des Verdrängten, Machthunger, Größenwahn, Geldgier oder den Eingriff des Menschen in das Erbgut).
Literatur (Auswahl)
Der Dichter Guiot de Provins äußerte sich in seinem Werk La Bible spöttisch über die Antoniusschweine, und Dante Alighieri kritisierte in seinem Werk Die Göttliche Komödie die Almosenfahrten der Antoniter. Franco Sacchetti schildert in seiner Novellensammlung Toskanische Novellen, anhand eines Beispiels mit dem Maler Giotto di Bondone, eine Begebenheit während eines Gottesdienstes, bei der ein freilaufendes Antoniusschwein in seiner Heimatstadt Florenz eine Rolle spielt. Noch detailreicher beschreibt Giovanni Boccaccio in seiner Novellensammlung Decamerone die Praktiken der Antoniter bei der Quest und die Präsentation der Reliquien.
In dem spanischen Theaterstück La fuerza de la costumbre (Die Macht der Gewohnheit) von Guillén de Castro werden die Antoniter ebenso erwähnt wie in den Dichtungen von Francisco de Quevedo A una nariz (Zur Nase) oder von Miguel de Cervantes Viaje del Parnaso (Reise zum Parnass).
In jüngerer Zeit wurden im deutschsprachigen Raum einige historisch angelegte Romane veröffentlicht, wie beispielsweise Antoniusfeuer von Yvonne Bauer oder der gleichnamige Roman von Tanja Bruske-Guth. Spielfilme hingegen, darunter der verfilmte und mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnete Krimi Antoniusfeuer von Monika Geier, sind eher selten.
Bekannte Antoniter

- Jean Borel deutsch-französischer Mediziner, Physiker, Hochschullehrer
- Petrus de Almancia, Präzeptor in Alzey und Teilnehmer an den Konzilien von Pisa und Konstanz
- Petrus Mitte von Caprariis, französischer Präzeptor, Generalvikar und Spezialkommissar des Abtes sowie des Konvents von Saint-Antoine und des ganzen Ordens
- Benoît de Montferrand, Bischof von Coutances und Lausanne
- Goswin von Orsoy, Generalpräzeptor in Lichtbergk und erster Kanzler der Universität Wittenberg
- Wolfgang Reissenbusch, deutscher Humanist, Rechtswissenschaftler, Theologe und in diplomatischer Mission für Friedrich dem Weisen
- François II. de Tournon, Kardinal und Staatsmann
- Giovanni Antonio Trivulzio, Bischof von Como, ab 1500 Kardinal
- Philippus Vaecx, Theologe und Kommandant des Antonitenklosters in Maastricht sowie Generalkomtur von Flandern und Maastricht
- Lambert Witinghof, deutscher Hochschullehrer, Rektor der Universität Rostock und Domherr in Lübeck
Forschungen und Dokumentationen zum Orden
Antoniter-Forum
Der Verein „Antoniter-Forum / Gesellschaft zur Pflege des Erbes der Antoniter“ wurde am 16. Februar 1991 gegründet. Er widmete sich der Erforschung und Dokumentation des Antoniterordens, befasste sich mit Kunst und Architektur im Umfeld des Antoniterordens, erteilte fachspezifische Informationen und verfolgte karitative Zwecke in Anlehnung an die Ziele der Antoniter. Zur Erfüllung der ersten Aufgabe der Gesellschaft, der Erforschung und Dokumentation des Antoniterordens, wurde 1993 die Zeitschrift Antoniter-Forum mit wissenschaftlichem Anspruch ins Leben gerufen. Am 7. Oktober 2017 wurde der Verein auf Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst.
Die normative Ordnung der Antoniter
Seit 2022 läuft ein Forschungsprojekt zum Antoniter-Orden am Forschungszentrum für vergleichende Geschichte religiöser Orden (FOVOG) an der TU Dresden. Ziel der Forschung ist es, die normativen Grundlagen des Antoniterordens zu beleuchten, verbunden mit einer systematischen Erfassung und Analyse der Medienausdrucksformen des Ordens sowie deren öffentlicher Zugänglichkeit (Bibliographie).[44]
Das Erbe heute
Eine Vielzahl von Klosterkirchen der Antoniter ist in Europa erhalten geblieben und wird heute weiterhin als Kirche oder Museum genutzt. Klostergebäude wie Hospize oder Klausuren sind hingegen nur selten oder gar nicht mehr anzutreffen.
Deutschland (Auswahl)

Heute trägt die Justus-Liebig-Universität Gießen ein blaues, silbergerandetes Tau-Kreuz in seinem Universitätswappen. Es verweist auf die Beziehungen zwischen dem nahegelegenen Antoniterkloster in Grünberg und der Universität Gießen. Die Universität Gießen erhielt durch eine Schenkung des Landgrafen Phillip I. einen Großteil des Klostervermögens des Antoniterklosters von Grünberg. Es lag nahe, das Antoniterkreuz als Symbol eines Hospitalsordens auch in das Wappen der Universität zu übernehmen, deren Medizinische Fakultät sich derselben Aufgabe verpflichtet hatte. Zudem wurde das Ordenskreuz in die 1896 gestiftete Universitätsfahne aufgenommen.[45] Auch der Landkreis Gießen führt in seinem Wappen das Tau-Kreuz, das auf das Leben und Wirken der Antoniter Bezug nimmt, ebenso wie die Gemeinden Mohrkirch in Schleswig-Holstein und Kloster Tempzin in Mecklenburg-Vorpommern.
Seit 1994 wird das ehemalige St.-Antonius-Kloster Tempzin als Pilgerkloster genutzt. Die Tradition des Antoniterordens, Pilger und Wallfahrer aufzunehmen, wird an diesem Ort weitergeführt. Die klösterliche Tradition des Ortes wird unter anderem durch Einkehrtage, Tageszeitengebete, Ora-et-labora-Wochen sowie Feste aufgegriffen und in zeitgemäßen Formaten fortgeführt.[46][47]
Das Antoniterquartier in Köln, rund um die Antoniterkirche, verdankt seinen Namen dem Wirken der Antoniter. Das vielseitige Nutzungskonzept des Quartiers umfasst Gemeinde- und Amtsfunktionen sowie gastronomische Angebote, Veranstaltungsräume und Mietflächen für Büros und Wohnungen.[48]
Im deutschen Sprachraum haben sich zahlreiche Bauernregeln zum St.-Antonius-Tag (17. Januar) erhalten.
Frankreich (Auswahl)
Das Kloster Saint-Antoine-l’Abbaye dient heute als historisches Denkmal und zieht zahlreiche Besucher an, die von seiner beeindruckenden Architektur und der reichen Geschichte fasziniert sind. Sowohl die Klosterkirche als auch einige andere Gebäude sind gut erhalten und für Besichtigungen geöffnet. Ein kleines Museum vermittelt Einblicke in die Geschichte des Klosters und des Antoniterordens. Die Kirche selbst wird weiterhin für Gottesdienste genutzt und bleibt ein bedeutender Ort der Andacht. Auch die Antoniterklöster in Pondaurat und Saint-Marc-la-Lande verfolgen ähnliche Nutzungskonzepte.
Heute setzt sich die Vereinigung Die Freunde der Antoniner für den Erhalt des kulturellen Erbes des Ordens ein. Sie publiziert regelmäßig u. a. in der Zeitschrift Les Antonins.
Spanien (Auswahl)
In Spanien werden auch heute noch einige Bräuche gepflegt und gefeiert, die durch die Antoniter Verbreitung fanden. Dazu gehören Tiersegnungen, die Festa popular de Sant Antoni oder Las Luminarias, die jährlich um den 17. Januar zu Ehren des heiligen Antonius stattfinden.[49][50][51]
In der Gesundheits- und Pflegeversorgung
Die Spezialisierung des Ordens auf eine spezifische Krankheit (Ergotismus) und die Entwicklung entsprechender Behandlungsmethoden ebneten den Weg für moderne medizinische Spezialisierungen und Behandlungsansätze, wie beispielsweise in der Onkologie oder Kardiologie. Ihre Hospitäler können als Vorläufer der heutigen modernen Krankenhäuser betrachtet werden und legten den Grundstein für deren Entwicklung. Zudem erarbeiteten sie normative Ordnungen und Statuten, die die Organisation und Verwaltung ihrer Spitäler regelten. Diese frühen Regelwerke hatten einen prägenden Einfluss auf die moderne Krankenhausverwaltung und -struktur.
Die Antoniter kombinierten pflegerische und kurative Tätigkeiten, wodurch sie sich von anderen Hospitalorden unterschieden. Ihre ganzheitliche Herangehensweise in der Patientenversorgung hob die Bedeutung der Integration von Pflege und Therapie hervor. Dieser Ansatz spiegelt sich heute in der integrativen Medizin und der ganzheitlichen Gesundheitsversorgung wider, bei denen Patienten als Ganzes betrachtet werden. Die Fürsorge für Schwerkranke und Sterbende durch Pflege und Trost hat zudem die moderne Hospiz- und Palliativpflege geprägt. Der Fokus liegt hierbei auf der Linderung von Schmerzen und der Verbesserung der Lebensqualität in der Endphase der Krankheit.[52]
Sontiges
Antoniter-Orden des Priesterkönigs Johannes
Im Jahr 1609 erschien in Spanien ein Buch von Juan de Baltazar, einem vermeintlichen abessinischen Ritter, das von einem afrikanischen Antoniter-Orden berichtete. Dieser soll im Jahr 370 vom äthiopischen Kaiser Johannes dem Heiligen gegründet worden sein, um gegen die arianischen Häretiker zu kämpfen. Unter Priesterkönig Johannes Philipp VII. expandierte der Orden und spaltete sich in zwei Zweige: die Mönche, die das Tau-Kreuz als Symbol trugen, und die Ritter, die ein Kreuz mit einer blauen Lilie und einem goldenen Rand führten.
Juan de Baltazar berichtete, dass die Ritter ab dem 16. Lebensjahr ein neunjähriges militärisches Noviziat durchlaufen mussten und später zu Mönchen wurden. Seine Erzählungen wurden später von Blas Antonio de Ceballos in dessen Werk aufgenommen, das 1686 in Madrid veröffentlicht wurde. Heute wird Baltazars Bericht als Fiktion angesehen, da keine Beweise für seine Behauptungen existieren.
Orden von Saint-Antoine-en-Barbefosse

Der Orden von Saint-Antoine-en-Barbefosse war ein kleiner Ritterorden, der im Jahr 1352 im damaligen Hainaut gegründet wurde. Die Gründung geht auf eine Gruppe von Rittern zurück, die auf einer Pilgerreise nach Jerusalem in eine verzweifelte Lage gerieten und von den Türken umzingelt wurden. In ihrer Not gelobten sie, sich dem hl. Antonius zu weihen, sollten sie gerettet werden. Nach ihrer sicheren Rückkehr setzten sie ihr Gelübde in die Tat um. Das goldene Tau auf rotem Grund wurde ihr Symbol.
Die Gründung des Ordens brachte Konflikte mit dem Orden in Saint-Antoine mit sich, da dieser keine unabhängigen Kultstätten für den heiligen Antonius duldete. Trotz eines anfänglichen Verbots errichteten die Ritter eine Kapelle bei Havré, die den Namen Saint-Antoine-en-Barbefosse erhielt. Durch die Unterstützung lokaler Adliger wie Gérard d'Enghien, Margarete von Hennegau oder Jacqueline von Bayern und die Spenden der Bevölkerung gelang es dem Orden, sich zu etablieren. 1415 wurde dem Orden schließlich die Erlaubnis erteilt, eine größere Kirche, ein Kloster und weitere Gebäude zu errichten, allerdings unter der Bedingung, dass diese dem Mutterorden in Saint-Antoine untergeordnet blieben.[53]
Siehe auch
Literatur
- Wolfram Aichinger: El fuego de San Antón y los hospitales antonianos en España. Turia + Kant, Wien 2009, ISBN 978-3-85132-574-4 (in spanischer Sprache).
- Peer Frieß (Hrsg.): Auf den Spuren des heiligen Antonius. Festschrift für Adalbert Mischlewski zum 75. Geburtstag. Verlag der Memminger Zeitung, Memmingen 1994, ISBN 3-927003-12-3.
- Iso Himmelsbach: Nihil est in actis – nihil? Die Generalpräzeptorei der Antoniter im Bistum Konstanz in Freiburg i. Br. In: Antoniter-Forum, Jg. 16 (2008) ISSN 0944-8985, S. 7–60.
- Johann Paul Gottlob Kircheisen: Beobachtungen über das Mutterkorn und dessen Entstehung. Seidler, Altenburg 1800, Digitalisat.
- Adalbert Mischlewski: Der Antoniterorden in Deutschland. In: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, Jg. 10 (1958), ISSN 0066-6432, S. 39–66 (Auch als Sonderdruck), online.
- Adalbert Mischlewski: Grundzüge der Geschichte des Antoniterordens bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts. (Unter besonderer Berücksichtigung von Leben und Wirken des Petrus Mitte von Caprariis) (= Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte, Bd. 8). Böhlau, Köln 1976, ISBN 3-412-20075-1 (zugleich: Diss., Universität München, Katholisch-Theolische Fakultät, 1969).
- Adalbert Mischlewski: Die Antoniter. In: Friedhelm Jürgensmeier, Regina Elisabeth Schwerdtfeger (Hrsg.): Orden und Klöster im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform, 1500–1700, Bd. 3. Aschendorff, Münster 2007, ISBN 978-3-402-11085-0, S. 123–136.
- Jakob Rauch: Der Antoniterorden, in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 9. Jahrgang 1957 S. 33–50
- Herbert Vossberg: Luther rät Reißenbusch zur Heirat. Aufstieg und Untergang der Antoniter in Deutschland. Ein reformationsgeschichtlicher Beitrag. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1968.
Weblinks
- Französische Vereinigung Die Freunde der Antoniter
- Gesellschaft zur Pflege des Erbes der Antoniter e.V.
- Antoniterkloster Höchst. hr retro 1963
- Wolfgang Jahn: Antoniter. In: Historisches Lexikon Bayerns
- Frankreichs mythische Orte E21: Saint-Antoine-l'Abbaye. arte 2013
- Lied zur Verehrung des hl. Antonius mit Bildern der Abtei Saint-Antoine, Vokalensemble Vox in Rama. youtube 25. November 2020
Einzelnachweise
- ↑ Der Heilige Antonius der Große. Refubium - Repositorium der Freien Universität Berlin 2011
- ↑ Jakob Rauch, Der Antoniterorden; Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 9. Jahrgang 1957, S. 33–50
- ↑ Der Antoniter-Orden. Antoniter Forum
- ↑ Adalbert Mischlewski: Grundzüge der Geschichte des Antoniterordens bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts. Böhlau Verlag. Köln Wien 1976
- ↑ Das Leben des heiligen Antonius des Einsiedlers Katholischer Seelsorgebereich Steigerwald 2025
- ↑ Alexandra Kohlberger: Memmingen. Antoniterkloster. In: Klöster in Bayern. Haus der bayrischen Geschichte 2025
- ↑ Hartmut Kraft: Das Antonius-Prinzip. Grunderfahrung aller Menschen. In: Deutsches Ärzteblatt. Heft 3, 2006, S. 137
- ↑ Franz J. Schnyder: Das Wappen der Antoniter. In: Archives héraldiques suisses. Annuaire 1973, S. 68
- ↑ Adalbert Mischlewski: Die Frau im Alltag des Spitals, aufgezeigt am Beispiel des Antoniterordens. In: Frau und spätmittelalterlicher Alltag 1986
- ↑ Karl Borchardt: Antoniter in den ältest-überlieferten päpstlichen Supplikenregistern 1342-1366. In: Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, Band 22 2022
- ↑ Alien Houses: Hospital of St Anthony. In: A History of the County of London. Volume 1, London Within the Bars, Westminster and Southwark, London 1909
- ↑ Beigitte Degiee-Spengleb: Forschungen über die Antoniter. In: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d'histoire = Rivista storica svizzera, 1975, Bd. 25, Heft 4
- ↑ Adalbert Mischlewski: Eine Hospitalordnung im Mittelalter, die regulären Kanoniker von Saint-Antoine-en-Viennonies, Presses Universtaires de Grenoble 1995
- ↑ Mischlewski Adalbert: Un ordre hospitalier au Moyen Âge, les chanoines regulars de Saint-Antoine-en-Viennois. Presses Universitaires de Grenoble 1995
- ↑ Adalbert Mischlewsiki: Die Antoniusreliquien in Arles - eine auch heute nochwirksame Fälschung des 15. Jh. (1988)
- ↑ Rudolf Schäfer: Die Kirche St. Justinus zu Höchst am Main. In: HÖCHSTER GESCHICHTSHEFTE 18/19 1973
- ↑ Historisches Lexikon Bayerns, Artikel Antoniter von Wolfgang Jahn www.historisches-lexikon-bayerns.de
- ↑ V. H. Bauer; Das Antoniusfeuer in Kunst und Medizin, Verlag Springer, Heidelberg
- ↑ Tamás Grynaeus: Die Antoniter in Ungarn (16.-18 Jh.) - Wandel in Tätigkeit und Lebensstil. In: ANTONITER-FORUM, 2007, Heft 15
- ↑ 1. Ausführungsbericht zum Plane des katholischen Fortbildungsinstitutes für Gesundheitsfürsorge (hrsg. im Auftrag des Deutschen Caritasverbandes). Köln 1930. S. 3f.
- ↑ Adalbert Mischlewski: Antoniter. In: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS) 9. Juli 1997
- ↑ Wolfgang Jahn: Antoniter. In: Historisches Lexikon Bayerns 20. September 2010
- ↑ Antoniter. In: katholisch.de 2025
- ↑ Luis Vázquez de Parga, José Ma. Lacarra, Juan Uría Ríu: Las peregrinaciones a Santiago de Compostela 1948–1949
- ↑ Vicente Cárcel Ortí: Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas. 1989
- ↑ Adalbert Mischlewski, Die Schreinsöffnungen in Saint Antoine, im Antoniter Forum 23-24-25/2015-16-17, S. 81
- ↑ Dom Hippolyte Dijon: L'église abbatiale de Saint-Antoine en Dauphiné. In: Histoire et Archéologie 1902
- ↑ Peter Johanek: Einungen und Bruderschaften in der spätmittelalterlichen Stadt 1993
- ↑ Adalbert Mischlewski: Soziale Aspekte der spätmittelalterlichen Antoniusverehrung. In: Laienfrömmigkeit im späten Mittelalter 1992
- ↑ Johann Eberlin von Günzburg: Sämtliche Schriften 1896–1902
- ↑ Der große Antonius und das Schwein. Kirche in WDR 4. 16. Januar 2024
- ↑ Wolfram Aichinger: Das Schwein des heiligen Antonius. Vom mittelalterlichen Spital ins spanische Gebirgsdorf. In: Historische Anthropologie, 2019, Vol. 7, No. 1
- ↑ Werner Dettelbacher: Vom Wirken der Antoniter in Würzburg. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 22, 2003, S. 81–88, hier: S. 84 f.
- ↑ Pierre Bachoffner: Bemerkungen zur Therapie des Antoniusfeuers. In: Antoniter-Forum 4 1996
- ↑ Elisabeth Clémentz: Le culte de saint Nicolas en Alsace. 2015
- ↑ Hans Georg Enzenroß: Das Antoniusfeuer. Die Geschichte einer vergessenen Krankheit. In: Villingen im Wandel der Zeit, 41 2018
- ↑ Elisabeth Clementz: Die Isenheimer Antoniter: Kontinuität vom Spätmittelalter bis in die Frühneuzeit?. Institut für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz e.V. 2001–2025
- ↑ Reiner Marquard: Mathias Grünewald und der Isenheimer Altar - Erläuterungen, Erwägungen, Deutungen. Stuttgart 1996
- ↑ Elisabeth Clementz: Die Isenheimer Antoniter: Kontinuität vom Spätmittelalter bis in die Frühneuzeit?
- ↑ Gerhard Uhlhorn: Die christliche Liebestätigkeit im Mittelalter. 1884, Bd. II, 178ff.
- ↑ Michael Buchberger: Lexikon für Theologie und Kirche. 1930, Bd. 1.
- ↑ Fritz Witte: Quellen zur rheinischen Kirchengeschichte., 1932, Bd. I
- ↑ Wilhelm Ewald: Die Rheinischen Schützenbruderschaften bis zum 19. Jh. In: Rheinischen Vereins f. Denkmalpflege u. Heimatschutz, Jg. 26, 1933, H. 1
- ↑ Nathalie Schmidt: Forschungsprojekt zum Orden der St. Anthony begann am 1. August 2022. TU Dresden 2022
- ↑ Das Wappen der Universität. Justus-Liebig-Universität Gießen 2025
- ↑ Tom Clauß: 800 Jahre Kloster Tempzin. Backnang 2022.
- ↑ Sophie Ludewig: Ein mittleres Wunder. Pilgerkloster Tempzin feiert 25-jähriges Jubiläum. Mecklenburgische und Pommersche Kirchenzeitung Nr. 23 2019.
- ↑ Antoniterquartier in Köln. baukunst-nrw 13. August 2024
- ↑ Tiersegnungen zu San Antonio - In einem Dorf an der Costa Blanca ist die Fiesta besonders urig. Costa Nachrichten 19. Januar 2024
- ↑ Julie Huehnken: Spanien: Göttlicher Segen für Haustiere. Gesellschaft/Europa. DW 18. Januar 2022
- ↑ Umstrittenes "Las Luminarias": Spanier treiben Pferde aus Tradition durchs Feuer. ntv 17. Januar 2025
- ↑ Elsanne Gilomen-Schenkel: Helvetia Sacra. Abteilung IV. Band 4. Die Antoniter, die Chorherren vom Heiligen Grab in Jerusalem und die Hospitaliter vom Heiligen Geist in der Schweiz. Basel - Frankfurt a. M. 1996
- ↑ Annales du cercle archéologique de Mons. In: Band XIX
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Jens Burkhardt-Plückhahn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Logo Pilger-Kloster - Bodenmosaik
Portail de l'Eglise Abbatiale de St Antoine l'Abbaye
Autor/Urheber: Justinusstifter, Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Justinuskirche Höchst Wappen der Antoniter am Hochaltar
Autor/Urheber: Pancrat, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Carte tirée de A. Mischlewski, Un ordre hospitalier au Moyen Age, PUG..
Autor/Urheber: Luis Rogelio HM, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Castrojeriz - 086
The Abbaye of Saint Antoine, the Sologne, France. Pilgrims suffering from ergotism (St Antony's fire) approaching the infirmary in which the relics and bones of the saint are preserved which were believed to cure the disease.
Iconographic Collections
Keywords: Ernest Board
Autor/Urheber: Eva K. / Eva K., Lizenz: CC BY-SA 2.5
Antoniterkreuz an der Nordfassade des ehemaligen Höchster Antoniterklosters
Philippus Vaecx alias Foxius, commandeur van de commanderie van Maastricht, 1628-1652, He wears the insignia of the Order of Saint-Anthony
Portrait of Nicolas Gasparini (1679-1747), abbot of Saint-Antoine-en-Viennois (1732-1747).
Autor/Urheber: Bjørn Christian Tørrissen, Lizenz: CC BY-SA 3.0
A window at the ruins of the Convento de San Antón from the 15th century, just east of Castrojeriz, Spain. The cross has a style with Egyptian origins, shaped like a T.
Arms of Bishop Peter Courtenay (d.1492), Bishop of Exeter and Bishop of Winchester, showing arms of See of Winchester impaling arms of Courtenay, the shield surrounded by three dolphins conjoined in annulo each vorant of the tail of the one in front, a dolphin being the heraldic device of the Courtenay family. In the top spandrels are shown three intertwined sickles, heraldic badge of the Hungerford family; in the lower spandrels are shown a garb of wheat, heraldic badge of the Peverell family. In the margins on either side are shown letters "tau" with a bell appended, symbols of St Anthony to whom the bishop had a special devotion.(A Delineation of the Courtenay Mantelpiece in the Episcopal Palace at Exeter by Roscoe Gibbs with a Biographical Notice of The Right Reverend Peter Courtenay, DD,... To which is added A Description of the Courtenay Mantelpiece compiled by Maria Halliday, privately published at the Office of the Torquay Directory, 1884). Detail from Bishop Courtenay's Mantelpiece, Bishop's Palace, Exeter.
Autor/Urheber: Mbzt, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Saint-Julien church - Arles
Autor/Urheber: Jens Burkhardt-Plückhahn, Lizenz: CC BY 4.0
Klosterkirche Tempzin Foto 2024
Autor/Urheber: Ginkgo2g, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Ehemalige Antonierkirche, Fassade zur Postgasse
Autor/Urheber: Source gallica.bnf.fr / BnF, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Les membres gangrénés par le mal des ardents étaient amputés.
Autor/Urheber: Eva K. / Eva K., Lizenz: CC BY-SA 2.5
Justinuskirche in Frankfurt-Höchst von Südosten.
Collection de costumes de tous les ordres monastiques, supprimés à differentes époques, dans la ci-devant Belgique, Bruxelles, Philippe Joseph Maillart et sœur, 1811
Autor/Urheber: Jean-Pol GRANDMONT, Lizenz: CC BY 3.0
Havré (Belgique), porteurs du reliquaire de Saint-Antoine-en-Barbefosse participant à la processsion dédiée à Notre-Dame de Bon Vouloir lors de la fête de l'Assomption.
Autor/Urheber: Chris06, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Antoniterschwein zu Füßen des heiligen Antonius, Kölner Dom, Nordportal































