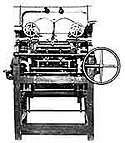Wirkmaschine

Eine Wirkmaschine stellt Maschenware mit Hilfe eines Systems von Nadeln sowie einiger Hilfselemente her, indem sich alle Nadeln gemeinsam bewegen und aus einem oder mehreren Fäden eine Reihe Maschen gleichzeitig bilden.
Maschenware aus einem Faden wird auf Kulierwirkmaschinen (auch Cottonmaschinen genannt) hergestellt, wobei zwischen Flachkulierwirkmaschinen und Rundkulierwirkmaschinen unterschieden wird.[1]
Ketten aus mehreren (bis mehr als 10.000) Fäden verarbeitet man auf Kettenwirkmaschinen. Diese werden in drei unterschiedlichen Konstruktionsarten hergestellt:
- Kettenwirkautomaten: Hochleistungsmaschinen mit begrenzten Musterungsmöglichkeiten
- Raschelmaschinen: Riesige Musterungsmöglichkeiten, breite Produktpalette
- Häkelgalonmaschinen: Gewirke mit einem durchgezogenen Schussfaden, geeignet für schmale Textilien.[2]
Ein früher Einsatz von Wirkmaschinen ist im Königreich Sachsen, beispielsweise 1851 bei G. Hilscher in Chemnitz belegt.[3]
Einzelnachweise
- ↑ Ines Wünsch: Lexikon Wirkerei und Strickerei. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-87150-909-4, S. 120.
- ↑ Marcus Oliver Weber, Klaus-Peter Weber: Wirkerei und Strickerei – Technologien - Bindungen - Produktionsbeispiele. 6., völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2014, ISBN 978-3-86641-299-6, S. 157.
- ↑ Blickdicht, S. 77, Kunstsammlungen Chemnitz, Seemann-Henschel-Verlag, Leipzig, 2004
Quellen
- Fabia Denninger, Elke Giese: Textil- und Modelexikon. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-87150-848-9.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Wirkmaschine Baujahr 1856